DAK-Studie zu Schulkindern: Müde, einsam, depressiv
DAK-Studie thematisiert Zusammenhang zwischen psychischer Gesundheit und Sozialstatus bei Schülern
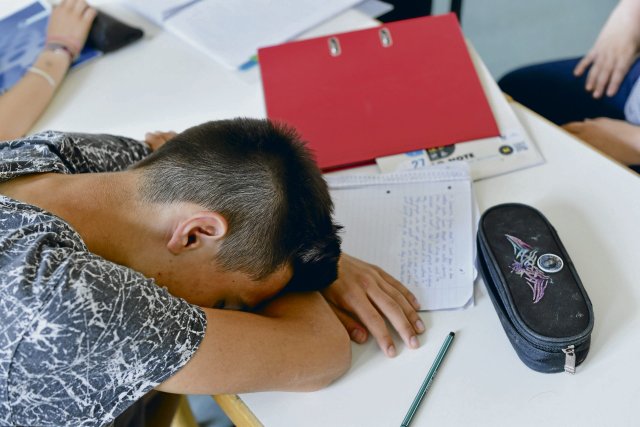
Mindestens ein Fünftel der Schüler in Deutschland ist auch nach Ende der Covid-Pandemie psychisch belastet. Sie nutzen digitale Medien drei Stunden täglich oder länger. Und fast jeder dritte Schüler litt schon vor der Pandemie an Schlafstörungen. Nur zehn Prozent der Mädchen und 20 Prozent der Jungen erreichten 2022 die empfohlene Mindestzeit von einer Stunde körperlicher Aktivität. All diese Zahlen sind länger bekannt, die Liste ließe sich fortsetzen.
Jetzt lieferte die Krankenkasse DAK in Ergänzung zu den Trends mit ihrem Präventionsradar Zahlen zur Gesundheitskompetenz[1] von Schülern. Der Bericht wurde am Dienstag in Berlin vorgestellt. Die Daten passen zu den bekannten Befunden und ergänzen sie: Denn nach der Erhebung für das Schuljahr 2024/2025 haben 84 Prozent der Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 10 keine ausreichende Gesundheitskompetenz. Die Kinder und Jugendlichen wurden gefragt, wie sehr sie sich für das Thema Gesundheit interessieren, wie wichtig es für sie ist, darüber etwas zu lernen, oder wie wichtig es ihnen ist, gesund zu leben.
»Die Einführung neuer Schulfächer ist sehr teuer.«
Mareike Wulf Parlamentarische Staatssekretärin
Die Fragen wurden zwischen November 2024 und Februar 2025 in 116 Schulen (aller Schulformen) aus 14 Bundesländern beantwortet. Mehr als 26 000 Schülerinnen und Schüler aus 1712 Klassen nahmen teil, sie füllten die Online-Fragebögen in der Regel in der Schule innerhalb von 45 Minuten aus. Das Schulpersonal sollte sich die Antworten nicht ansehen.
Durchgeführt wurden die Befragungen vom gemeinnützigen Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung in Kiel. Das Thema Gesundheitskompetenz wurde im Rahmen des Präventionsradars zum ersten Mal aufgegriffen. Die früheren acht Befragungen hatten andere Schwerpunkte gesetzt, darunter der Substanz- und Medienkonsum.
Bei der Gesundheitskompetenz zeigte die Untersuchung keinen Geschlechterunterschied, aber einen Bildungsgradienten: Denn von den Schülern an Gymnasien hatten mit 18,9 Prozent hier noch deutlich mehr gute Werte gegenüber den 13,7 Prozent der Schüler aller anderen Schulen. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass vier Fünftel der Gymnasiasten auch nur eine niedrige bis moderate Kompetenz in Gesundheitsfragen angab. Unterschiede zeigten sich ebenso im Sozialstatus, der in dieser Befragung subjektiv erfasst wurde. Von den Befragten, die sich selbst einen mittleren oder hohen Status zuschrieben, sahen sich 16,2 Prozent Gesundheitsthemen eher gewachsen. Wurde ein niedriger Sozialstatus angegeben, waren das nur 11,9 Prozent.
Die Fragen zur Gesundheit umfassten in dieser Ausgabe des Präventionsradars auch psychosomatische Beschwerden: Am häufigsten wurden Erschöpfung und Schlafprobleme genannt. So gaben 45,9 Prozent der Kinder an, sich mehrmals pro Woche erschöpft zu fühlen, 30 Prozent hatten ebenso oft Schlafprobleme. Rücken-, Kopf- und Bauchschmerzen wurden von deutlich weniger Kindern mit dieser Häufigkeit angegeben. Schlafprobleme treffen eher Kinder mit niedrigem sozialen Status, häufiger Mädchen, Heranwachsende zwischen 14 und 17 Jahren eher als Jüngere. Oft einsam fühlen sich fast die Hälfte der Kinder mit niedrigem sozialen Status sowie 41 Prozent der Mädchen. Am wenigsten einsam fühlen sich die Jungen, nur ein Viertel von ihnen hat hier ein ständiges Problem.
Unter dem Strich zeigen die Zahlen, dass Kinder ohne ausgeprägte Gesundheitskompetenz häufiger erschöpft, traurig und einsam[2] sind. DAK-Vorstandschef Andreas Storm plädiert für ein neues Schulfach Gesundheit und Prävention, um sie zu stärken und zu schützen.
Darüber, dass staatliches Handeln dringend erforderlich ist, sind sich die Kieler Wissenschaftler, Krankenkasse und auch die bei der Vorstellung anwesende Bildungsstaatssekretärin Mareike Wulf (CDU) einig. Am stärksten unter Druck steht die Politik. Da aber schulische Bildung Ländersache ist, kommt Wulf hier mit allgemeinen Förderabsichten und weiterem Forschungsbedarf durch. Oder sie adressiert eben die Gesundheitskompetenz von Eltern und Lehrern. Als frühere Landespolitikerin wirbt sie um Verständnis für die hohen Hürden in der Realpolitik: »Die Einführung neuer Schulfächer ist sehr teuer.«
Für ein neues Schulfach Gesundheit und Prävention hat dieser Tage der Drogenbeauftragte der Bundesregierung Hendrik Streeck geworben. Er würde es für sinnvoll halten, wenn dort Medienbildung allgemein und auch Suchterkrankungen ein Thema wären.
Andererseits gab und gibt es bereits gute Ansätze und erfolgreiche Modellprojekte für Gesundheit. Ein Beispiel sind die Gesundheitsfachkräfte an Schulen. Sie können an Schulen Routine-Untersuchungen und Gesundheitsbildung anbieten. In Notfällen versorgen sie Kinder. Und sie helfen auch bei Fragen zur psychischen und sexuellen Gesundheit. Hier wurden befristete Projekte aber immer wieder zu den Akten gelegt oder Bundesländer zogen sich aus der Finanzierung zurück. [3]
»Es gibt einen Flickenteppich von Versuchen, aber wir kommen nicht wirklich voran«, beklagt DAK-Chef Storm. Eine Hoffnung hat er derzeit: »Es ist ein Glücksfall, dass jetzt Bildung und Familien unter dem Dach eines Ministeriums zu finden sind.« Damit könnte, wie es sich auch Staatssekretärin Wulf vorstellt, auch die Elternarbeit an den Schulen mit anderen Maßnahmen gebündelt werden.
Links:
- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1161029.onkologie-weniger-vorsorge-hoehere-risiken.html?sstr=Gesundheitskompetenz
- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1187083.kindergesundheitsbericht-wenig-bewegung-an-den-schulen.html?sstr=Gesundheitsfachkräfte
- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1175047.bildungspolitik-berliner-schulen-niemand-will-fuer-gesundheit-zahlen.html?sstr=Gesundheitsfachkräfte