Sozialverträglicher Suizid
Die Debatte über Sterbehilfe ist geprägt von Einzelfällen und einer abstrakten Freiheitsethik. Um Pflegenotstand, Armut und Einsamkeit geht es selten
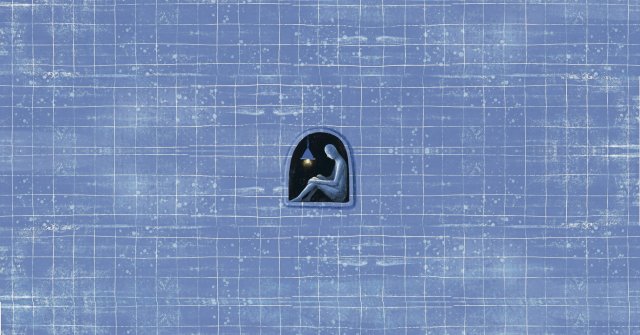
Am 4. September 2025 starb Niki Glattauer, ein bekannter österreichischer Autor und Lehrer. Etwas an seinem Tod war ungewöhnlich: Glattauer hatte seinen Todestag selbst festgelegt. Noch ungewöhnlicher war, dass er wenige Tage vor seinem Tod der österreichischen Zeitung »Falter« und dem Nachrichtenportal »Newsflix« ein langes Interview gab, in dem er von seinen Motiven berichtete – um aufzuklären, wie er sagt. Aufklären wollte er über die Möglichkeit der Sterbehilfe in Österreich. Denn das war sein Weg und seine Entscheidung: der assistierte Suizid. Niki Glattauer war terminal an Krebs erkrankt und wollte, wie er sagte, in Würde sterben.
Die öffentlichen Debatten über das Thema Sterbehilfe kranken zumeist an einer Engführung auf Einzelschicksale, sie lassen soziale Aspekte außen vor. Die Empathie und das Mitgefühl für das Leiden der jeweiligen sterbenswilligen Person überdecken so die systemischen Implikationen, die eine Liberalisierung der Sterbehilfe mit sich bringt. So gut wie jedes westliche Land hat einen eigenen Glattauer: In Australien sorgte das Schicksal Bob Dents für eine Reform, in Frankreich fachten unter anderem die Fälle Chantal Sébire und Vincent Lambert Diskussionen an und in Kanada erwirkte Kay Carter im Jahr 2015 eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs, welche die Grundlage legte für das jetzige »Program Medical Assistence in Dying« (MAID). Nachdem zu Beginn des Jahrtausends bereits die Niederlande und Belgien den assistierten Suizid legalisiert hatten, entschieden sich in der EU seit 2021 auch Spanien, Portugal und Luxemburg für diesen Weg. In Deutschland wird es ebenfalls zu einer Liberalisierung kommen, nachdem das Bundesverfassungsgericht die bisherige Regelung zur »gewerbsmäßigen Förderung der Selbsttötung« bereits im Februar 2020 kippte.
Man kann also von einer allgemeinen Tendenz in Richtung Liberalisierung[1] sprechen, die sich seit 30 Jahren abzeichnet und immer stärker wird. Die Argumente für die Sterbehilfe ähneln sich dabei: Es geht um den Schutz des Individuums, um die Freiheit der Entscheidung, um Würde und Selbstbestimmung. Niki Glattauers Position unterscheidet sich hier nicht fundamental von jener, die etwa Walter Jens und Hans Küng 1995 in ihrem Buch »Menschenwürdig sterben« vertraten oder Georg Diez in dem 2015 erschienenen Essay »Die letzte Freiheit – Vom Recht, sein Ende selbst zu bestimmen«. Wie frei diese Entscheidung aber tatsächlich ist, klingt zumindest bei Niki Glattauer zwischen den Zeilen an: Er berichtet auch darüber, dass neben der Krebserkrankung auch andere Gebrechen vorlägen – die Hüfte, das Herz –, aber die medizinische Versorgung in Österreich derart schlecht sei, dass er nun schon monatelang auf Behandlungsmöglichkeiten warte. In seiner Erzählung bleibt dies aber ein Nebenstrang. Wichtiger ist für ihn die Feststellung, dass jeder Mensch selbst bestimmen darf, wann er stirbt. Aber es ist schlicht ein Irrtum, dass diese Entscheidung immer autonom getroffen wird.
Risikofaktor Marginalisierung
Ein konkretes Beispiel: Das kanadische Sterbeprogramm MAID ist eines der freizügigsten Sterbehilfeprogramme weltweit. Es besteht aus zwei sich ergänzenden sogenannten Tracks: Track 1 bezeichnet den assistierten Suizid für Menschen, deren baldiger Tod als vorhersehbar gilt. Track 2 hingegen betrifft Patient*innen, deren Tod medizinisch nicht vorhersehbar ist, die aber wegen eines nicht behebbaren Leidens den Tod wählen. Laut kanadischem Gesundheitsministerium starben im Jahr 2023 15 343 Personen durch MAID, davon 622 unter Track 2. Der Zuwachs an MAID-Toten im Vergleich zum Vorjahr beträgt damit 15,8 Prozent. Unter Track 2 fallen für das Jahr 2023 622 Fälle. Die Zahl von 622 Todesfällen unter Track 2 scheint zunächst gering im Vergleich. Erfahrungen aus den Niederlanden und Belgien, aber auch aus Kanada selbst lassen aber annehmen, dass diese Art von Liberalisierung einige Jahre braucht, um ihr volles Potenzial zu entfalten. Eine weitere Liberalisierung von MAID, die auch Menschen mit alleinig psychischer Diagnose betreffen soll, wurde vorerst ins Jahr 2027 verschoben.
Einer Kanadierin wurde von offizieller Stelle vorgeschlagen, sich umbringen zu lassen, als sie versuchte, die Finanzierung für eine Rollstuhlrampe zu beantragen.
Allerdings zeigen die Entwicklungen in Kanada schon jetzt, dass MAID eine gefährliche soziale Schieflage innewohnt. Ramona Coelho, Ärztin in der Provinz Ontario, konstatierte im Interview mit der Wochenzeitung »Jungle World«, dass fast 30 Prozent der Track-2-Toten zuvor in Armut lebten, 6,7 Prozent hatten keine feste Wohnadresse. Weniger als die Hälfte habe »Zugang zu psychischer Gesundheitsversorgung, Beratung oder Unterstützungsangeboten« gehabt. Es sterben also in erster Linie die Marginalisierten an MAID.
Das zeigt sich auch in den konkreten Fällen: Noch vor Einführung von Track 2 mehrten sich die Berichte von Kranken und Behinderten, die von medizinischem Personal in die Sterbehilfe getrieben werden sollten. Alan Nichols, ein depressiver Mann Anfang 60, wurde laut seiner Familie zum Suizid gedrängt, wobei die ausschlaggebende Diagnose nicht etwa seine Depressionen waren, sondern »Hörverlust«.
Christine Gauthier, Veteranin und Paralympionikin, wurde von offizieller Stelle vorgeschlagen, sich umbringen zu lassen, als sie versuchte, die Finanzierung für eine Rollstuhlrampe zu bekommen. Roger Foley nahm während seines Krankenhausaufenthaltes heimlich jene Gespräche auf, die ein Arzt mit ihm führte, um ihn zum assistierten Suizid zu bewegen – schließlich koste seine Behandlung »über 1500 Dollar« am Tag. Acht Tage vor ihrem Tod im Februar 2022 sagte eine kanadische Frau, die den Tod wählte, weil sie keine ihrer Behinderung entsprechende Wohnung fand, über die Gründe ihres assistierten Suizids: »Die Regierung sieht mich als Müll, als Nörglerin, nutzlos, ich gehe ihnen auf den Sack.« Zwei Jahre lang hatte sie sich zuvor an jede mögliche Stelle gewandt, um Hilfe zu bekommen, doch niemand hatte ihr geholfen.
Auch in Deutschland ist, wie bereits angesprochen, von einer baldigen weiteren Liberalisierung auszugehen. Das Bundesverfassungsgericht schrieb in seiner Entscheidung: »Die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, umfasst auch die Freiheit, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen.« De jure könnte damit der Weg frei sein für eine Landschaft von Sterbehilfevereinen, wie sie etwa die Schweiz kennt. Allerdings konnte sich der Bundestag bisher auf keinen Gesetzentwurf einigen, um die notwendig gewordene Reform des entsprechenden Paragrafen 217 des Strafgesetzbuchs umzusetzen.
Die Befürworter*innen dieser Reformen können sich darauf verlassen, eine Mehrheit der Bevölkerung hinter sich zu haben. 2021 sprachen sich laut Umfragen 72 Prozent der Deutschen für eine Legalisierung aktiver Sterbehilfe aus. Tatsächlich scheiterten weitere Schritte im Sinne einer Öffnung bisher in erster Linie an christlich-konservativem Widerstand im Parlament und weniger an links-humanistischen Einwänden. Die gibt es allerdings auch: Insbesondere aus den Reihen der Behindertenrechtsbewegung wird diese Entwicklung stark kritisiert. Denn die Liberalisierung fällt zusammen einerseits mit einer älter und auch kränker werdenden Bevölkerung, andererseits mit einem massiven Sozialstaatsabbau. Der Pflegenotstand verschlimmert sich Jahr für Jahr, während – auch durch die Covid-Pandemie – die Zahl chronischer Erkrankungen massiv zugenommen hat. Zugleich ist der Pflegemarkt, insbesondere die Altenpflege und der Krankenhaussektor, seit den 90ern zunehmend dem Markt überlassen worden, angesichts der Tatsache, dass die letzten sechs Monate eines Menschenlebens die teuersten sind, was Gesundheitskosten anbelangt. Es ergibt sich der zwar zynisch klingende, aber naheliegende Schluss, dass mit einer Ausweitung der Sterbehilfe auch die gestiegenen volkswirtschaftlichen Gesundheitskosten reduziert werden könnten.
Tendenz zur Dystopie
Gesellschaftspolitische Entwicklungen während der Covid-19-Pandemie stützen diese Befürchtung. Zwar schien der Schutz der Risikogruppen angesichts der ersten Infektionswellen zunächst zumindest nominelles Ziel der Politik zu sein, es wurde aber spätestens nach Verfügbarkeit der Impfung komplett aufgegeben. Ohnehin war dieser Schutz nicht viel mehr als ein Lippenbekenntnis; zu Hochzeiten der Pandemie gab es flächendeckend Fälle sogenannter stiller Triage, das bedeutet, Pflegeheime wurden angewiesen, keine schwer erkrankten Bewohner*innen in Notaufnahmen zu überführen. Viele dieser Menschen würden schließlich ohne intensivmedizinische Betreuung in ihren Zimmern sterben.
Die grundlegende, institutionalisierte Verachtung der kapitalistisch organisierten Gesellschaft für alles Schwache, Gebrechliche und als krank Markierte gehört zu einer Diskussion über Sterbehilfe ebenso wie die liberale Erzählung vom Individuum, das seine letzte freie Entscheidung trifft. Aber die Inszenierung einzelner Kranker, die in einem »letzten heroischen Akt« (Dietz) ihre Freiheit und Würde im Willen zum Tod finden, hilft nicht bei der Orientierung im Thema: Anstatt über die große Rolle aufzuklären, die soziale Benachteiligung in der Entscheidung zum assistierten Suizid spielt, wird eine abstrakte bürgerliche Ethik aufgerufen. Unter solchen Bedingungen wird eine dystopische Welt immer realistischer, die sich lieber von ihren »Überflüssigen« befreit, anstatt soziale Verhältnisse einzurichten, in denen Menschen nach ihren Bedürfnissen versorgt werden.
Links:
- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1191407.sterbehilfe-frankreich-fuer-ein-sterben-in-wuerde.html?sstr=euthanasie
Quelle: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1194425.euthanasiedebatte-sozialvertraeglicher-suizid.html