Digitaler Medienimperialismus
Rechte und Liberale wollen die Marktmacht der großen US-Tech-Konzerne brechen. Warum sich Linke dieser Forderung nicht vorschnell anschließen dürfen
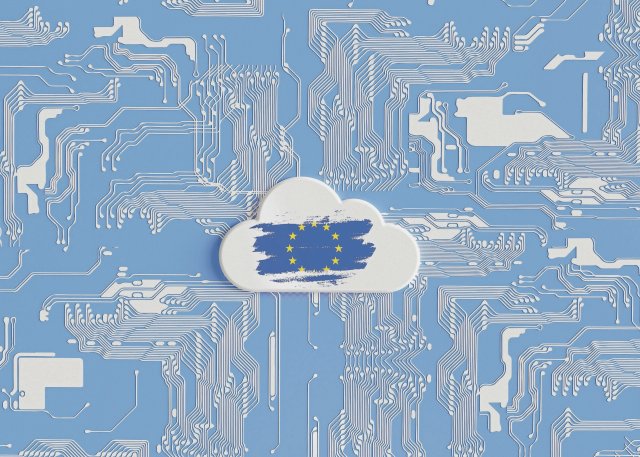
Big Tech ist ein Problem. Darin sind sich in Europa praktisch alle politischen Lager einig. In den Augen von Wirtschaftsliberalen bewirken Google, Meta und ähnliche Unternehmen eine Verzerrung des Wettbewerbs und in rechts-konservativen Kreisen gelten ihre Vorgaben für zulässige Inhalte als zu restriktiv oder progressiv. Auch in linken Kreisen gehört es zum guten Ton, die Macht US-amerikanischer Tech-Konzerne »bändigen« zu wollen. Scheinbar ist Big Tech damit eines der wenigen Themen, um die sich breite politische Allianzen schmieden ließen. Das gilt umso mehr in Europa, wo die gemeinsame Zugehörigkeit zum europäischen Markt weite Teile der politischen Kräfte gegen die US-Tech-Giganten zusammenschweißt.
Dieses mehr oder weniger gemeinsame Banner trägt seit einer Weile einen Namen: »digitale Souveränität«[1]. Unter diesem Label versammeln sich jene, die US-amerikanische Digitalkonzerne aus unterschiedlichen Gründen kritisch sehen und ihnen heimische Alternativen entgegensetzen wollen. Was aber hat die gesellschaftliche Linke dabei zu gewinnen?
Gleiche Mittel, ungleiche Ziele
Der gemeinsame Kampf gegen die problematischen Abhängigkeiten von Big Tech ist bei näherer Betrachtung nur eine brüchige Fassade[2]. Die Einigkeit besteht maximal darin, Symptome zu benennen. Darüber, warum diese Symptome überhaupt unerwünscht sind, welche strukturellen Ursachen ihnen zugrunde liegen und ob man diese Ursachen überhaupt beheben will, besteht kaum Einvernehmen. Im Gegenteil: Hier zeigt sich die Gefahr, gleiche Mittel mit gleichen Zielen zu verwechseln.
Ein Beispiel dafür ist eine jüngere Forderung des rechten Verlegers und Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien Wolfram Weimer. In einem Interview mit dem Mediendienst »Politico« des Axel-Springer-Konzerns forderte er, Google zu zerschlagen[3], denn der Konzern bedrohe mit seiner Marktmacht die Meinungsfreiheit. Mit dieser Forderung ist er nicht allein. Auch die Zivilgesellschaft macht sich derzeit für eine Zerschlagung stark: Lobby Control, Rebalance Now, die Petitionsplattform We Act von Campact und We Move Europe haben über 150 000 Unterschriften für die Zerschlagung von Google gesammelt. Die Europäische Kommission hatte zuvor in einem kartellrechtlichen Verfahren ein Bußgeld gegen Google verhängt, weil das Unternehmen ihr zufolge seine Stellung auf dem Markt der Online-Werbung missbraucht hat.
Eine geteilte Kritik an Big Tech ist noch lange keine geteilte gesellschaftliche Vision.
-
Wenn Rechte und Konservative eine Gefahr für die Meinungsfreiheit wittern, liegt dem nicht der Wunsch zugrunde, einen kritischen und offenen Diskurs zu bewahren, sondern die Dominanz ihrer Positionen zu sichern. Nachdem Donald Trump im Januar 2025 erneut als Präsident vereidigt worden war und mit dem Umbau der Vereinigten Staaten zu einem autoritären Staatsapparat begonnen hatte, übernahmen die Tech-Konzerne in Windeseile die Rolle williger Handlanger. Der Meta-Konzern beendete die Zusammenarbeit mit Faktenchecker*innen, stellte das konzerninterne Diversitäts- und Inklusionsprogramm ein und erklärte es für zulässig, Mitglieder der LGBTQ-Community als psychisch krank zu bezeichnen.
Die Fähigkeit, direkten Druck auf Meta auszuüben, um das Handeln des Konzerns auf Linie mit der eigenen politischen Agenda zu bringen, fehlt in Europa. Eine Zerschlagung von Google oder anderer Digitalkonzerne, oder auch nur eine entsprechende Drohung, ist aber jedenfalls ein mittelbares Werkzeug, um Druck auf die Geschäftspraktiken der Unternehmen auszuüben. Eine solche Forderung aus dem Kreise der europäischen Rechten ist deshalb nicht überraschend. Sie drückt allerdings keine Kritik an der ökonomischen und diskursiven Macht der Konzerne aus, sondern sie ist Ausdrucks des Wunsches, diese Macht unter die eigene Kontrolle zu bringen. Sich mit dieser Kritik gemein zu machen, weil man bei der Wahl der Mittel zufälligerweise übereinstimmt, birgt das große Risiko, eine Agenda zu unterstützen, deren Ziele von denen einer progressiven Bewegung kaum weiter entfernt sein könnten.
Ein MAGA-Medienimperium
In der Einschätzung dazu, was Teil des Sagbaren sein sollte, steht Weimer jedenfalls den Ideen des Trump-Regimes nahe. Er untersagte in seiner Behörde die Nutzung inklusiver Sprache, übte mit dem Vorwurf von Antisemitismus Druck auf einen Kulturbetrieb aus, um den Auftritt eines palästinasolidarischen Künstlers zu verhindern, und er vertrat in seinem 2018 erschienen Buch erzkonservative Familien- und Geschlechterbilder. Wenn Rechte ihre entsprechenden Ziele hinter der Kritik gegen Marktmacht verstecken, darf sich linke und progressive Digitalpolitik nicht unkritisch mit ihnen verbunden sehen. Eine geteilte Kritik an Big Tech ist noch lange keine geteilte gesellschaftliche Vision.
Anschaulich wird die Zwickmühle am Beispiel Tiktok[4]. Noch unter der Biden-Regierung hatten die USA ein Gesetz erlassen, das den chinesischen Mutterkonzern der Social-Media-Plattform verpflichtete, den US-Teil der Plattform zu verkaufen, und alternativ mit dessen Verbot in den USA gedroht. Ende September 2025 scheint die Übernahme von Teilen Tiktoks nun tatsächlich Wirklichkeit zu werden. Eine Gruppe von Investoren soll die Kontrolle über den Algorithmus und die Daten für US-Nutzende übernehmen, darunter der Oracle-Gründer Larry Ellison, ein enger Vertrauter Trumps. Ellison, der sich mit Elon Musk ein Rennen um den Titel des reichsten Menschen auf der Welt liefert, besitzt mit seiner Familie bereits ein beachtliches Medienportfolio, das auch den Sender CBS und das Medienunternehmen Skydance umfasst. CBS setzte vor einigen Wochen Stephen Colberts »Late Show« ab, die sich kritisch zu Trump geäußert hatte. Das US-Nachrichtenmagazin »Newsweek« oder auch die BBC sprechen in diesem Kontext von einem neuen Medienimperium im Dienste der Maga-Bewegung. Die Übernahme des US-Geschäfts von Tiktok und die Kontrolle darüber, welche Inhalte dort in Zukunft zulässig sind, welche künstlich verstärkt und welche keine Reichweite bekommen, ist ein relevanter Schritt im autoritären Umbau der Vereinigten Staaten.
In der Europäischen Union sind derartige Schritte noch weiter entfernt und in ihrer autoritären Zielsetzung weniger offensichtlich. Das US-Vorbild findet nichtsdestotrotz nahrhaften Boden in den derzeitigen Debatten über »digitale Souveränität«. Unter dem Sammelbegriff wird derzeit eine Vielzahl an Plänen und Vorhaben diskutiert, um die Union weniger abhängig von US-amerikanischen Digitalkonzernen zu machen. Dahinter verbirgt sich jedoch auch ein narratives Fundament für gleichermaßen autoritäre und nationalistische Ziele. »Digitale Souveränität« meint vielfach schlicht Programme zur Stärkung europäischer Digitalunternehmen. Deren Ziel ist demnach nicht, die Abhängigkeit von Tech-Unternehmen generell, sondern die Abhängigkeit von ausländischen Tech-Unternehmen zu reduzieren. Nicht Google und seine Marktmacht sind das Problem, sondern die Tatsache, dass sich das Unternehmen dem heimischen Zugriff entzieht. Es braucht deshalb nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie etwa der Medienkonzern des verstorbenen Rechtspopulisten Silvio Berlusconi, Media for Europe, ein aus Google abgespaltenes EU-Geschäft übernimmt und ein solcher Schritt dann als Stärkung der europäischen digitalen Souveränität gefeiert würde.
Und die Alternative?
Wie sieht dagegen eine linke digitalpolitische Position aus? Sie beginnt zwingend damit, sich nicht naiv vereinnahmen zu lassen von rechts-konservativer Kritik an Marktmacht. Eine linke Position muss benennen, dass das Problem nicht in einer zu stark in den USA konzentrierten Marktmacht besteht, sondern im Markt und im Privateigentum an sich. Kommerzielle digitale Plattformen und Dienste unterliegen im Kapitalismus der alleinigen Verfügungsgewalt ihrer Eigentümer*innen. Die Vorstellung, dass europäische Eigentümer*innen sich auch nur ansatzweise von US-amerikanischen oder chinesischen unterscheiden, ist eine Illusion. Und die Vorstellung, dass europäische Konkurrent*innen nicht genauso dem Diktat des Profits folgen müssten und sich dafür den gegebenen politischen Umständen anpassen würden, ignoriert die Erfahrungen des Schulterschlusses zwischen Kapital und Staat im historischen Faschismus.
Die linke Antwort kann nicht darin liegen, sich für fairen Wettbewerb einzusetzen, sondern muss in dem Ausbruch aus Profitlogik, privater Verfügungsmacht und Markt selbst liegen. Aufbauend auf diesem Bruch mit den Logiken des Kapitalismus ist es dann möglich, Plattformen, Infrastrukturen und Dienste in eine öffentliche Verwaltung unter demokratische Kontrolle zu überführen, die den Interessen aller verpflichtet ist, statt der revisionistischen Gesellschaftsvorstellung privilegierter Minderheiten.
Links:
- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1193271.it-sicherheit-digitale-souveraenitaet-n-noch-ein-fernes-ziel.html
- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1191607.it-infrastruktur-digitale-souveraenitaet-ist-ein-luftschloss.html
- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1193751.suchmaschinen-google-zerschlagung-in-den-usa-vom-tisch.html
- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1191985.social-media-doch-nicht-tiktoks-letzter-tanz.html