Von Macht und Ohnmacht
Rainer Werning über den Marcos-Clan, die philippinische Zivilgesellschaft und Lieblingsautoren
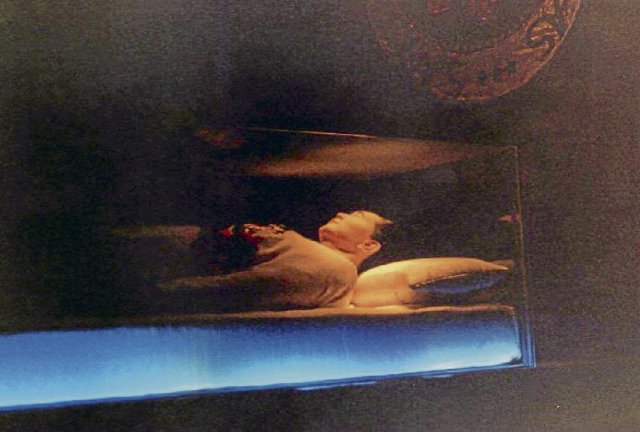
Den meisten Menschen hierzulande sind die Philippinen nur aus Hochglanzkatalogen der Reiseveranstalter bekannt oder aus den Nachrichten über Naturkatastrophen wie das Erdbeben jüngst. Glauben Sie, mit Ihrem neuen Buch über Land und Leute auf Interesse in Deutschland zu stoßen?
Natürlich, sonst wäre das Buch nie entstanden. Uns geht es darum, die neuere Geschichte samt aktueller Entwicklungen zu fokussieren und der Leserschaft Brücken zu bauen, die Philippinen und die Filipinos zu verstehen.
Ihr Buch berichtet über die Ereignisse und Entwicklungen in den Philippinen seit 1965 – ein Jahr, das man vor allem mit dem blutigen Putsch im Nachbarinselstaat Indonesien verbindet.
Gewiss. Was in Indonesien geschah, war ein Massaker gargantuesken Ausmaßes, wo Hunderttausende Menschen in einem von General Suharto und seinen Schergen orchestrierten antikommunistischen Blutrausch hingemetzelt wurden. Marcos trat in jenem Jahr sein Amt an, wurde 1969 wiedergewählt und verhängte 1972 das Kriegsrecht. Beiden Diktatoren ging es vermeintlich um die Errichtung einer »Neuen Ordnung« beziehungsweise einer »Neuen Gesellschaft«. Neu war letztlich »nur« das Ausmaß staatlichen Terrors!
Wie kommt es, dass die Geschichte der Philippinen vor allem von einem Familienclan bestimmt wurde? Was durchaus auch auf andere Staaten im Globalen Süden zutrifft. Liegt das daran, dass es den jungen, kolonialbefreiten Nationalstaaten an eigenen Demokratieerfahrungen mangelte? Oder weil es sich bei jenen vielfach um multiethnische, multireligiöse Gemeinwesen handelt?
Da werden gleich mehrere ebenso komplexe wie komplizierte Sachverhalte und Problemfelder angesprochen, die just in unserem Opus thematisiert werden. Da in dieser Jahreszeit die Nächte länger werden, lohnt es sich, das Buch entsprechend »durchzuarbeiten«. Kernpunkt mit Blick auf die Philippinen ist die Jahrhunderte währende Kolonialzeit unter den Spaniern und den USA – von einem etwa vierjährigen japanischen »Intermezzo« abgesehen. In all diesen Jahren hat sich eine Elite herausgebildet beziehungsweise mit tatkräftiger Unterstützung der jeweiligen Kolonialmacht etabliert, die in Gestus und Habitus bis heute neofeudal geprägt ist und die unterschiedlichsten Formen der Herrschaftssicherung unter sich aushandelte – bestenfalls als »Elitendemokratie« inklusive Machtrochaden und interner Absprachen. Demgegenüber war Marcos Senior daran gelegen, als erster Präsident seines Landes systematisch die unterschiedlichen Apparate des Staates zu konzentrieren und zu zentralisieren. Um, wie es ihm vorschwebte, jenen Entwicklungsweg einzuschlagen, der bei Anrainern wie Singapur, Taiwan, Japan und Südkorea zu sogenannten »Tigerökonomien« führte. Dieses ambitionierte Unterfangen scheiterte unter anderem daran, dass bis heute keine tiefgreifende und den Namen verdienende Land- und Agrarreform durchgeführt wurde. Endemische Korruption, Vetternwirtschaft, Patronagepolitik und Militarisierung zwecks eigenen Machterhalts waren schließlich mit ausschlaggebend dafür, dass Marcos senior scheiterte. Hinzu kommen »Nachwehen« der Kolonialzeit. Da wäre zweierlei hervorzuheben.
Und das wäre?
Die philippinische Elite und/oder deren dominante Familienclans und Dynastien lieben es, ihren Reichtum im Sinne kastilischer Grandezza ostentativ zur Schau zu stellen. Aus Sicht der US-Amerikaner, die die Inseln als einstige und einzige Kolonie in Asien von 1898 bis 1946 beherrschten, blieben die Mitglieder der philippinischen Oberschichten schlichtweg ihre »kleinen braunen Brüder« und bis heute die verlässlichsten antikommunistischen Verbündeten. Und geostrategisch dienen die Philippinen als unsinkbarer Flugzeugträger in der Region Südostasien/Ostasien/Pazifik. Diese ist zudem der Schauplatz, wo entschieden wird, wer künftig die Hegemonialmacht Nummer 1 ist.
Marcos senior regierte mit eiserner Hand, unterdrückte jegliche Opposition und wurde nicht zur Verantwortung gezogen – im Gegenteil, auf dem Heldenfriedhof von Manila beigesetzt. Und »Bongbong«, wie sein Sohn genannt wird, ist seit 2022 Präsident.
Wenngleich Marcos senior im Februar 1986 mit Schimpf und Schande aus dem Amt gejagt und von seinen einstigen US-amerikanischen Gönnern mitsamt einer ihm treu ergebenen Entourage ins Exil auf Hawaii verfrachtet wurde, blieb der Einfluss der Marcos-Familie ungebrochen – dank eines stets intakt gebliebenen klientelistischen Netzwerks und der Höhe ihres kleptokratisch zusammengerafften Vermögens, das auf zehn Milliarden US-Dollar geschätzt wurde. Sämtliche Nachfolgeregierungen waren damit beschäftigt, sich selbst und ihre im Amt erworbenen Pfründe zu wahren. Amnesie und Straflosigkeit waren, sind und bleiben bis auf Weiteres so etwas wie Staatstugenden. Nicht zu unterschätzen ist auch der Einfluss der mächtigen katholischen Bischofskonferenz in dem vorwiegend römisch-katholischen Land: Riefen deren Bischöfe und Kardinäle Anfang 1986 noch zu Massenprotesten gegen Marcos auf, predigten ebendiese Herren ein halbes Jahrzehnt später allseitige Vergebung und Versöhnung. In einem solch wohligen Umfeld kehrten die Marcoses aus dem Hawaiier Exil zurück, ergatterten zunächst lokale und regionale Ämter, um schließlich über Senatsposten erneut das höchste Staatsamt zu bekleiden – mit machtvoll inszeniertem Geschichtsrevisionismus und »positiver Dauerbeschallung« qua sozialer Medien.
In den Philippinen gibt es noch nicht mal so etwas wie die Wahrheitskommissionen in Südafrika und keine Aufarbeitung der Verbrechen wie in Kambodscha. Liegt das an einer zu schwachen Zivilgesellschaft?
Nein. Das Land hat eine sehr vitale Zivilgesellschaft, die es bislang – leider noch – nicht vermochte, die Zitadellen politischer Macht zu erklimmen. Noch sind die Bastionen staatlicher Herrschaft gepanzert. Die aktuell das Land erschütternden Wellen allseitiger Korruption – vor allem im Bereich des Hochwasser- und Katastrophenschutzes – könnten geeignet sein, strukturelle Veränderungen herbeizuführen, unter anderem zur Herausbildung programmatisch ausgerichteter Parteien und/oder Organisationen sowie veränderte Curriculae im Bildungs- und Ausbildungsbereich. Außerdem müssten die Brandmarkung legitimen Protests und Widerstands als »subversiv« und »terroristisch« unverzüglich eingestellt sowie dem einzig im Sinne der Mächtigen elastischen Justizsystem ein Riegel vorgeschoben werden.
Sie haben in Ihrem Band eine Vielzahl von Autoren vereint, vor allem Stimmen von vor Ort, mit unterschiedlichem Hintergrund.
Ja, das ist auch gut so. Perspektivenwechsel sind grundsätzlich bereichernd, weshalb mein Ko-Herausgeber und ich bewusst deutschsprachige und philippinische Autor*innen »ins Boot geholt« haben, um einen Facettenreichtum zu gewährleisten.
Sie selbst sind privat mit den Philippinen verbunden?
Seit reichlich einem halben Jahrhundert ist Mary Lou meine liebe Lebensgefährtin, die aus jener Provinz stammt, nämlich Laguna, in der auch der in den Philippinen als Nationalheld verehrte Dr. José Rizal geboren wurde. Sie ist als Übersetzerin, Dolmetscherin sowie interkulturelle Trainerin tätig und seit Jahren Vorsitzende von »Babaylan«, einem europaweiten Netzwerk sozialpolitisch engagierter Filipinas.
Glauben Sie, dass das Interesse an Kultur und Literatur der Philippinen hierzulande gestärkt werden könnte, weil der Inselstaat Gastland auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse ist? Haben Sie einen philippinischen Lieblingsautor oder eine Lieblingsautorin?
Ja, was Ihre erste Frage betrifft. Zu meinen Lieblingsautoren gehören der vor drei Jahren verstorbene Schriftsteller Francisco Sionil José und der Medizinanthropologe Gideon Lasco. Letzterer ist ein sehr scharfsinniger Beobachter des Alltäglichen, und er schreibt ebenso konzise wie luzid – seine Worte sind wohlgeschliffene Perlen. Sionil Josés Werk ist eine ebenso opulente wie ätzende Sozialkritik, die – generationenübergreifend – die Wunden einer Gesellschaft offenlegt, die von vielen Übeln geplagt wird. Er galt eine Zeit lang als Anwärter auf den Literaturnobelpreis und war in der jüngeren Geschichte der erste in Englisch schreibende Autor der Philippinen, dessen Werke ins Deutsche übersetzt wurden.
Rainer Werning und Jörg Schwieger stellen ihr Buch am 17. Oktober, 17 Uhr, auf einer Veranstaltung unter dem Motto »Philippines – Migration, Diaspora, Exil« an der Goethe-Universität Frankfurt a. M. vor, Neue Mensa, Bockenheimer Landstraße 133. Zudem gibt es eine Lesung der beiden Autoren in der Messestadt auch noch am 18. Oktober, 19 Uhr, im Café ExZess, Leipziger Str. 91.
Quelle: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1194785.frankfurter-buchmesse-von-macht-und-ohnmacht.html