- Politik
- Google, Amazon und Israel
3900 Schekel bedeuten »Italien«
Google und Amazon sollen Israel heimlich über Anfragen von Sicherheitsbehörden informieren

Wenn ausländische Ermittler*innen auf israelische Regierungsdaten zugreifen, die in den Cloud-Plattformen von Google oder Amazon gespeichert sind, sollen die Konzerne eine heimliche Mitteilung senden – getarnt als Finanzüberweisung. Diese ungewöhnliche Vereinbarung geht aus geleakten israelischen Regierungsdokumenten hervor, die der britische »Guardian« gemeinsam mit dem israelisch-palästinensischen »+972 Magazine« und der hebräischsprachigen Publikation »Local Call« ausgewertet hat. Auf diese Weise wird die Regierung in Jerusalem beispielsweise informiert, wenn nationale oder internationale Staatsanwaltschaften oder Gerichte wegen Verbrechen in den palästinensischen Gebieten ermitteln und dazu die Herausgabe von Daten bei Tech-Anbietern verlangen.
Der sogenannte »Zwinkermechanismus« ist Teil des Projekts »Nimbus«, das Google und Amazon 2021 mit der israelischen Regierung begonnen haben. Es regelt die Speicherung israelischer Regierungs-, Militär- und Geheimdienstdaten in Cloud-Rechenzentren der US-Konzerne. Israel fürchtete, dass Strafverfolgungs- oder Sicherheitsbehörden anderer Länder im Falle von Ermittlungen über Gerichtsbeschlüsse Zugriff darauf erlangen könnten.
Wie andere große Technologieunternehmen sind Google und Amazon verpflichtet, auf rechtlich bindende Anfragen von Polizeien oder Geheimdiensten – aus den USA oder dem Ausland – zu reagieren und Kundendaten herauszugeben. Schweigeanordnungen einzelner Behörden oder von Gerichten verbieten den Firmen jedoch, betroffene Kund*innen über die Datenweitergabe zu informieren.
Um dennoch gewarnt zu werden, forderte Israel ein verdecktes Benachrichtigungssystem: Google und Amazon müssen innerhalb von 24 Stunden nach einer Datenweitergabe eine »Sonderzahlung« an die israelische Regierung überweisen, deren Höhe der Telefonvorwahl des anfragenden Landes entspricht. Eine Anfrage aus den USA, deren Vorwahl +1 lautet, führt zu einer Zahlung von 1000 Schekel. Bei einer Anfrage aus Italien mit der Vorwahl +39 müssten 3900 Schekel überwiesen werden. Falls die Schweigeanordnung so streng ist, dass selbst die Nennung des Landes untersagt wird, bestimmt der Vertrag eine Summe von 100 000 Schekel – umgerechnet etwa 26 000 Euro.
Neben dem geheimen Benachrichtigungssystem enthält der »Nimbus«-Vertrag eine weitere fragwürdige Klausel: Google und Amazon ist es untersagt, Israels Zugang zu ihren Cloud-Diensten einzuschränken oder zu sperren – selbst wenn die Regierung gegen Nutzungsbedingungen der Unternehmen verstößt. Diese Regelung sollte verhindern, dass Google oder Amazon nach Protesten von Mitarbeiter*innen, Aktionär*innen oder Entscheidungen von Gerichten unter Druck geraten – beispielsweise bei Vorwürfen von Menschenrechtsverletzungen in den besetzten palästinensischen Gebieten. Die Medien zitieren aus einem internen Regierungs-Memo aus Israel, wonach die Unternehmen »die Sensibilitäten der israelischen Regierung« verstünden.
Den Berichten zufolge kommt der Konkurrent Microsoft der israelischen Regierung weit weniger entgegen: Der Tech-Riese hatte den Zugang einer Militäreinheit zu bestimmten Cloud- und KI-Diensten auf seiner Azure-Plattform gesperrt, nachdem bekannt geworden war, dass dort abgehörte palästinensische Telefonate gespeichert waren. Microsoft begründete den Schritt damit, man sei nicht »im Geschäft der Massenüberwachung von Zivilist*innen«.
Unter den »Nimbus«-Vertragsbedingungen würde eine solche Sperre als »Diskriminierung« der israelischen Regierung gewertet und könnte Klagen wegen Vertragsbruchs gegen Google und Amazon nach sich ziehen. Microsoft hatte sich ursprünglich ebenfalls um den »Nimbus«-Auftrag beworben, unterlag aber in der Ausschreibung. Der »Guardian« zitiert Quellen, wonach Microsofts Angebot unter anderem daran scheiterte, dass der Konzern einige der israelischen Forderungen nicht akzeptieren wollte.
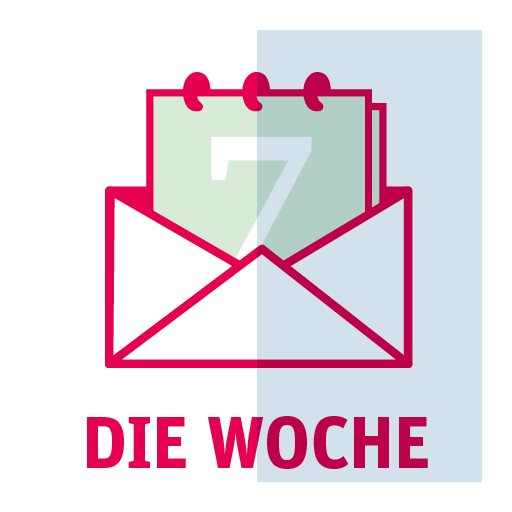
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Weder Google noch Amazon beantworteten die Frage, ob sie den geheimen Code seit Inkrafttreten des »Nimbus«-Vertrags auch verwendet haben. Das Projekt »Nimbus« steht seit Israels Militäroffensive im Gazastreifen unter besonderer Kritik. Während der auch von UN-Einrichtungen als Genozid bezeichneten Offensive setzte das israelische Militär stark auf Cloud-Anbieter, um große Datenmengen und Geheimdienstinformationen zu speichern und zu analysieren.
Auch deutsche Polizeien und Geheimdienste könnten von der Auskunftsfreudigkeit der Konzerne gegenüber Israel betroffen sein – so diese überhaupt irgendetwas Kritisches hinsichtlich israelischer Kriegsverbrechen unternehmen. Der Bundesnachrichtendienst will sich dazu auf nd-Anfrage nicht äußern und schickt seine Standard-Antwort: Man nehme »zu Angelegenheiten, die etwaige nachrichtendienstliche Erkenntnisse oder Tätigkeiten betreffen, grundsätzlich nicht öffentlich Stellung«. Das BKA erklärt noch schmallippiger, man kommentiere keine Medienberichterstattung.
Die Linke-Abgeordnete Clara Bünger, die jüngst erfolglos für einen Sitz im Parlamentarischen Kontrollgremium für die Geheimdienste kandidierte, hält die Weitergabe der Informationen durch Google und Amazon indes für unzulässig. Ermittlungen nach dem Völkerstrafgesetzbuch könnten erschwert werden, wenn die Behörden davon ausgehen müssten, dass ihr Vorgehen den Beschuldigten – in diesem Fall in Israel – gegenüber offengelegt werden kann. Es handele sich dabei auch um einen Eingriff in die staatliche Souveränität, so Bünger. Wenn Ermittlungsbehörden fürchten müssten, dass ihre Abfragen Behörden anderer Staaten bekannt werden, verzichteten sie womöglich darauf.
Die Abfragen könnten für die Betroffenen aber auch entlastend sein. Die Linksfraktion drängt deshalb auf einen stärkeren Vertraulichkeitsschutz bei der Beantwortung von Auskunftsverlangen. Derartige Regelungen fehlten etwa für das BKA. Tech-Firmen wie Google und Amazon sollten ihre Dienstleistungen in Deutschland nur anbieten können, »wenn sie diese Vertraulichkeit verbindlich und bußgeldbewährt zusichern«.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.






