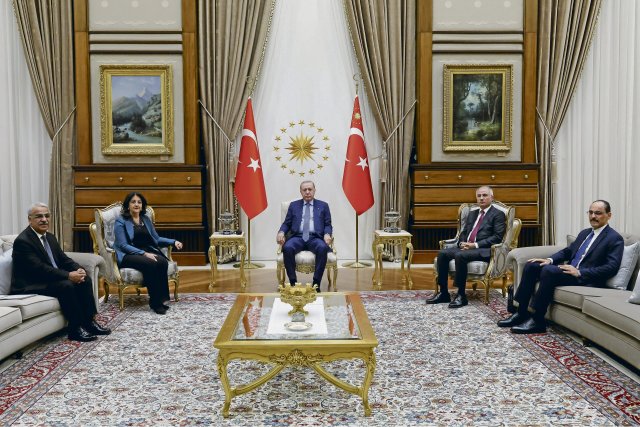- Politik
- Albanien
Zypressen zum Gedenken
Ruinen und gepflanzte Bäume erinnern in Tepelenë an ein dunkles Kapitel der albanischen Geschichte

Kein Schild weist den Weg. Kein Tor öffnet sich. Das ehemalige Internierungslager von Tepelenë existiert heute fast nur noch im Gedächtnis einiger weniger – und in den Ruinen am nördlichen Ende der Kleinstadt. In Reiseführern findet es, wenn überhaupt, nur am Rande Erwähnung.
Die Kleinstadt Tepelenë schmiegt sich an den Hang, friedlich und unaufgeregt. Unten in der Ebene liegen die Überreste eines dunklen Kapitels ihrer Geschichte. Von 1949 bis 1953 befand sich hier eines der berüchtigten Internierungslager des sozialistischen Albanien. Angehörige der früheren Elite, Offiziere, Intellektuelle und deren Familien wurden hier inhaftiert – Menschen, die das neue Regime als Gefahr betrachtete.
Als das Lager eröffnet wurde, war der junge sozialistische Staat gerade fünf Jahre alt. Die Nationale Befreiungsbewegung hatte 1944 die Wehrmacht aus dem Land getrieben, und unter Enver Hoxha verwandelte sich Albanien in einen stalinistischen Überwachungsstaat. Ein Netz von Internierungslagern und Gefängnissen überzog das Land – von der Adriaküste bis in die entlegenen Bergregionen. Zehntausende wurden in den folgenden Jahrzehnten inhaftiert, viele ohne Anklage oder Urteil. Wer widersprach, verschwand hinter Stacheldraht.
Weiden und Ruinen
Der Weg zu dem ehemaligen Lager ist heute beschwerlich. Das Navi sucht vergeblich nach einem Ziel, berechnet immer wieder neue Routen, als wolle der Ort sich selbst verbergen. Schließlich endet die Straße auf einem Feldweg. Ein Sportplatz grenzt fast direkt an das Gelände, dahinter breitet sich Brachland aus. Die Ruinen sind schon zu sehen, als es mit dem Auto nicht mehr weitergeht. Die letzten Meter gehen wir zu Fuß.

Das Gelände ist überwuchert, umgeben von provisorischen Stacheldrahtzäunen. Sie sollen keine Eindringlinge abhalten, sondern Schafe und Ziegen im Zaum halten. An eine bröckelnde Mauer gelehnt döst ein älterer Mann in der warmen Herbstsonne – umgeben von seinen Tieren. Zwischen ihnen wirkt er wie der letzte Wächter eines vergessenen Ortes.
Krenar Çota heißt er, ist Schäfer und überaus gesprächig. Nach seiner englischen Frage, woher wir kommen, wechselt er ins Deutsche. Drei Jahre hat er in den 1990er Jahren in München gelebt und als Kfz-Mechaniker gearbeitet. Wie viele Albaner war er damals fortgegangen, als die Wirtschaft zusammenbrach und das Land kaum Arbeit bot. Anfang der 2000er Jahre kehrte er zurück – in seine Heimatstadt Tepelenë. Zwei Amtszeiten lang war er Bürgermeister in der Kleinstadt mit rund 3700 Einwohnern, bevor er wieder Schäfer wurde.
Eine Führung mit dem Schäfer
Das Lager? Ja, das kenne er gut, sagt Çota und bietet sofort eine Führung an. »350 Kinder sind hier gestorben. Kinder. Das muss man sich vorstellen«, sagt er und bahnt sich den Weg Richtung Lagergelände. Er schiebt eine mit Stacheldraht gesicherte Europalette zur Seite – und plötzlich stehen wir mitten auf dem ehemaligen Kasernengelände.
Das Internierungslager der Hoxha-Ära hatte eine Vorgeschichte. In den 1940er Jahren, während der italienischen Besatzung, wurde es als Kaserne errichtet. Nachdem die Besatzer abgezogen waren, stand die Anlage zunächst leer, bevor sie 1949 als Lager wieder in Betrieb genommen wurde.
Çota selbst hat diese Zeit selbst nicht miterlebt – er ist 68 Jahre alt. »Hier direkt nebenan«, sagt er und zeigt auf die Gebäude am Rand des Geländes, »wurde unter der Hoxha-Diktatur eine große Bäckerei gebaut«. Auch dieses Gebäude verfällt – wie das gesamte Areal. Von den Baracken stehen nur noch die Außenmauern. Heute tummeln sich Hühner, Schafe und Kühe auf dem Areal. Auch Çota hat einen Teil des Geländes von der Gemeinde gepachtet, um seine Schafe nachts unterzubringen.
An einigen Stellen der ehemaligen Baracken sind die verbliebenen Fensteröffnungen mit Plastikplanen bespannt. Vereinzelt gehen Menschen daran vorbei. Ob hier Tiere oder Menschen hausen, ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen – und auch der Schäfer ist sich da nicht sicher.
In der Mitte des ehemaligen Appellplatzes zeichnet sich immerhin ein Ansatz von Gedenken ab: Zypressen wurden in regelmäßigen Abständen in einem Quadrat gepflanzt, in der Mitte steht ein quadratisches Betonfundament. »Eigentlich sollte hier längst eine Gedenkstätte errichtet werden. Aber sehen Sie selbst – das Gebiet ist völlig verwahrlost«, sagt er und klingt verärgert.
Der sonst so gutmütige Schäfer kommt nun in Fahrt. »Die Sozial-Kommunisten haben kein Interesse an einer Aufarbeitung«, sagt er. Mit »Sozial-Kommunisten« meint er die Politiker der Sozialistischen Partei, die 1991 aus der bis dahin allein herrschenden Partei der Arbeit Albaniens hervorging. Anders als in vielen anderen ehemals sozialistischen Staaten Osteuropas vollzog sich der Wandel in Albanien schrittweise. Nach dem Tod des Langzeitdiktators Enver Hoxha im Jahr 1985 übernahm Ramiz Alia die Regierungsgeschäfte. Nach Massenprotesten fanden 1991 die ersten freien Wahlen statt – aus denen Alia erneut als Sieger hervorging.
Einen wirklichen Umbruch gab es erst, als Sali Berisha – Vertreter der Demokratischen Partei – im Jahr darauf nach Neuwahlen der erste nicht-sozialistische Präsident Albaniens wurde. Doch die Sozialistische Partei blieb eine starke politische Kraft und prägt die Politik des Landes bis heute. Viele ehemalige Funktionäre aus kommunistischer Zeit blieben noch lange in Amt und Würden.
Krenar Çota ist Mitglied der Demokratischen Partei. Die Aufarbeitung der Hoxha-Ära ist ihm ein persönliches Anliegen. Bis heute sucht man jedoch vergeblich nach einer Gedenkstätte für die Opfer des Terrors. Nur in den Ausstellungen Bunk’Art 1 und Bunk’Art 2 in Tirana erfährt man mehr über das Lagersystem der ehemaligen Volksrepublik Albanien. Dass diese Aufarbeitung überhaupt stattfand, ist dem langjährigen Engagement der Zivilgesellschaft zu verdanken – nicht politischen Entscheidungen. Die ehemaligen Gefangenenlager zerfallen heute fast überall im Land.
Besonders berüchtigt war das Lager Spaç, tief in den Bergen im Norden. In den Kupferminen mussten die Häftlinge unter schwersten Bedingungen arbeiten. Verlässliche Angaben zu den Opferzahlen gibt es nicht – ebenso wenig wie in Tepelenë. Dort wurden die Gräber nach der Auflösung des Lagers eingeebnet. Çota spricht immer wieder von 350 getöteten Kindern, andere Schätzungen gehen von bis zu 1000 Toten aus.
Mit EU- und Schweizer Geldern wurden auf dem Gelände immerhin drei Gedenkstelen errichtet, die an das Leid der Opfer erinnern. Sie nennen 1500 Familien mit insgesamt 3380 Insassen. Darunter waren 1254 Frauen, 963 Männer und 1163 Kinder. 285 Kinder starben an Ruhr.
Inzwischen haben die Stelen Rost angesetzt. »Seit 2018 ist hier nichts mehr geschehen«, sagt Çota. »Keine Aufarbeitung, nichts.« Dabei sah vor sieben Jahren alles noch so vielversprechend aus. Damals fand auf dem Gelände eine große Gedenkveranstaltung statt. Viele Gäste waren geladen, der Appellplatz war feierlich bestuhlt und geschmückt. In der ersten Reihe saßen ehemalige Lagerinsassen. Der damalige Präsident Ilir Rexhep Meta zeichnete vier von ihnen für ihre »besonderen bürgerlichen Verdienste« aus. Es gab Urkunden und Orden. Fotos zeigen den Präsidenten neben hochbetagten Überlebenden.
Bei der Gedenkveranstaltung wurden Videoinstallationen gezeigt, die Aufzeichnungen eines ehemaligen Insassen an die Wände der Ruinen projiziert. Dicht gedrängt in Etagenbetten lagen einst die Menschen in den Kasernengebäuden – gezeichnet von Unterernährung und den Strapazen des Lagerlebens. Krenar Çota zieht Vergleiche zu den Konzentrationslager der Nazis – so eng seien die Menschen in die Baracken gepfercht worden und dort gestorben. Geblieben ist von dieser Gedenkveranstaltung jedoch wenig.
Von weiteren geplanten »Meilensteinen« liest man nur noch in einer Dokumentation. Die Willensbekundungen klingen ehrgeizig: »Das Projekt umfasst die Wiederherstellung der Identität einer Baracke des Lagers.« Darüber hinaus sollten »mehrere Jungbäume (Zypressen) zum Gedenken an die Kinder ohne Grab« gepflanzt werden. Auch war ein »nationales Denkmal für Zwangsarbeiterlager« vorgesehen. Immerhin wurden 300 Zypressen gepflanzt – für jedes gestorbene Kind eine. Das Betonfundament wurde gegossen, ein Gedenkstein mit albanischer Inschrift aufgestellt.
Andere Aushängeschilder
»Sieben Jahre nach den markigen Worten und Versprechungen ist hier sonst nichts mehr geschehen. Weder kann man das Lager besuchen, noch gibt es das versprochene ›Museum für Zwangsarbeiterlager‹«, sagt Çota wütend. Als Bürgermeister hatte er keine Verfügungsgewalt über die Ruinen oder ihre Umwandlung in eine Gedenkstätte. Auch die heutige Regierung unter Edi Rama zeige wenig Interesse an Aufarbeitung und Erinnerung, was Çota enttäuscht.
In Tepelenë selbst präsentiert man lieber andere Aushängeschilder – die schöne Burg etwa oder den berühmtesten Sohn der Stadt: Ali Pascha. Ein großes Denkmal ehrt den 1741 geborenen Pascha, der einst große Teile des osmanischen Albaniens und Griechenlands beherrschte. Für das Lager Tepelenë dagegen fehlt jeder Wegweiser. Es fristet, in Stacheldraht gehüllt, ein trostloses Dasein.
Nur sporadisch kommen Touristen vorbei, wie man in Internet-Einträgen lesen kann. Ein würdevolles Gedenken sieht anders aus. Krenar Çota glaubt nicht mehr daran, dass auf dem Betonfundament jemals ein Mahnmal entstehen wird. Er will nur noch in Ruhe seine Schafe hüten. Die Erinnerungspolitik, so scheint es, ist schon vor ihm in Rente gegangen.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.