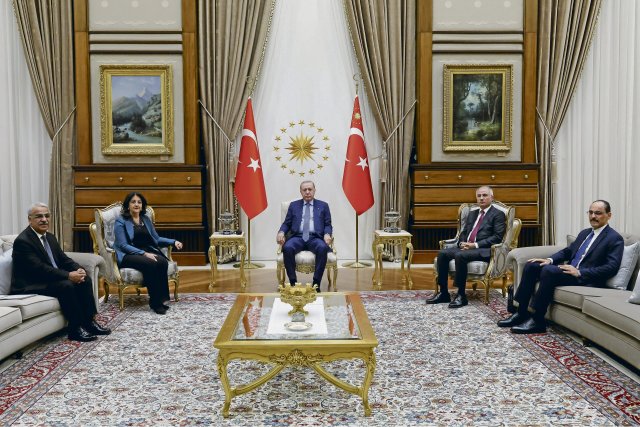- Politik
- Grundrechte
Studie zur Bezahlkarte: Geflüchtete bezahlen mit ihrer Freiheit
Der Mediendienst Integration veröffentlicht die dritte Untersuchung zum Stand der Aufnahme und Integration Schutzsuchender

Seit Anfang des Jahres bekommen Geflüchtete in fast ganz Deutschland Sozialleistungen über eine Bezahlkarte. Bereits im Voraus war für Kritiker*innen klar, dass es dabei vor allem um die Gängelung von Geflüchteten gehen sollte – und nicht darum, Überweisungen ins Ausland zu unterbinden oder Behörden zu entlasten, auch wenn die ehemalige Innenministerin Nancy Faeser (SPD) die Einführung der sogenannten Socialcard damit begründet hatte.
Das erste Argument widerlegen schon der Blick in die Studienlage sowie die Zahlen der Bundesbank: Sozialleistungen tragen demnach kaum zu Überweisungen in Herkunftsländer bei – der Großteil stammt von Arbeitsmigrant*innen oder von Geflüchteten, die einen Job gefunden haben. Dies erscheint auch logisch: »Wer von 440 Euro Sozialhilfe lebt, hat am Monatsende nicht viel übrig«, so Matthias Lücke, Ökonom am Institut für Weltwirtschaft. Tatsächlich haben die Überweisungen ins Ausland seit der Einführung der Bezahlkarte zugenommen – ein weiteres Indiz dafür, dass beides wenig miteinander zu tun hat.
Doch wie steht es um die zweite Begründung, den angeblichen Bürokratieabbau durch die Bezahlkarte? Eine Antwort darauf findet sich in der nun veröffentlichten, dritten Untersuchung zum Stand der Aufnahme und Integration von Geflüchteten, die der Mediendienst Integration gemeinsam mit Forschenden der Universität Hildesheim regelmäßig durchführt. Von 167 zur Bezahlkarte befragten Gemeinden, Städten und Landkreisen gaben rund 40 Prozent an: Auch nach den erwartbaren Anlaufschwierigkeiten bleibt der Aufwand für die Verwaltung dauerhaft erhöht. Etwa gleich viele Befragte stellten indes eine Arbeitserleichterung fest. Die Veränderungen in beide Richtungen wurden zumeist als gering eingestuft.
Was hat es mit den unterschiedlichen Einschätzungen auf sich? Die Autor*innen des Berichts vermuten einen Zusammenhang mit dem vorherigen System der Auszahlung: Im Vergleich zu Überweisungen auf Girokonten bedeutet die Bezahlkarte Mehraufwand; im Vergleich zur persönlichen Bargeldauszahlung Erleichterung. Unabhängig davon sind mit dem neuen Vorgehen Arbeitsschritte hinzugekommen: Händische Freigaben einzelner Aufträge und bestimmter Funktionen etwa, oder Beratungsgespräche.
Dass die Bezahlkarte in den Kommunen auf Skepsis stößt, zeigt das Beispiel Nordrhein-Westfalen (NRW): Dort wurde ihnen freigestellt, ob sie das neue Zahlungsinstrument einführen. 86 Prozent der befragten Gemeinden, Städten und Landkreise verzichten bislang laut Bericht auf die Einführung.
Ein etwas anderes Bild zeichnet eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes unter den Landesministerien aus dem Juli: Demnach wolle nur jede dritte Kommune in NRW auf die Bezahlkarte verzichten. Auch Städte in Niedersachsen befürchten einen Mehraufwand und wehren sich gegen die Karte. Lediglich in Bayern und Sachsen-Anhalt sei die Karte flächendeckend eingeführt.
Im Bargeldland Deutschland bringen Abhebelimits erhebliche Einschränkungen mit sich.
Wie sich die Bezahlkarte auf das Leben der Betroffenen auswirkt, damit befasst sich keine der beiden Umfragen. Überweisungen ins Ausland sind damit überhaupt nicht, inländische Überweisungen nur teilweise möglich – genau wie Online-Einkäufe. In den meisten Bundesländern können Betroffene pro Monat lediglich 50 Euro in bar abheben. Gerade im Bargeldland Deutschland bringt das erhebliche Einschränkungen mit sich. Kleinere Geschäfte lehnen Kartenzahlungen oft ab, auf Flohmärkten oder auf Kleinanzeigenportalen ist die Bezahlkarte ebenfalls kaum nutzbar. »Familien, denen nur wenig Geld zur Verfügung steht, können daher etwa einen Schulrucksack oder Kinderschuhe nicht gebraucht kaufen, obwohl sie hierauf zwingend angewiesen sind«, schreibt die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF).
Seit dessen Einführung klagt die Organisation gegen das Instrument. »Anstelle von Geldleistungen eine Bezahlkarte auszugeben, verletzt den Anspruch auf ein Existenzminimum nicht per se. Es muss aber sichergestellt sein, dass der individuelle Bedarf der Menschen tatsächlich gedeckt werden kann«, erklärt Sarah Lincoln die das Rechtsteam der GFF mitleitet. »Das ist bei der restriktiv ausgestalteten Bezahlkarte nicht der Fall.«
Bisher ist die Bilanz der Verfahren durchwachsen: Einen ersten Erfolg in einem Eilverfahren gegen ein zu geringes Bargeldlimit vor dem Hamburger Sozialgericht hob das Landessozialgericht Hamburg auf, weil es keine Eilbedürftigkeit sah. Ähnlich sieht es mit einem Fall in Bayern aus. »Eine Entscheidung zu den rechtlichen Fragen, die sich auf die Sozialkartenpraxis auswirken könnte, wird es also erst im Hauptsacheverfahren geben«, so Lincoln gegenüber »nd«. »Und die sind leider langwierig.«
Erfolgreicher scheint derweil der Widerstand gegen die Bezahlkarte aus der Zivilgesellschaft: Die Geflüchtetenorganisation Seebrücke listet fast 90 Kartentausch-Initiativen gegen die Bezahlkarte. Deren Prinzip ist einfach: Die Geflüchteten kaufen bei einem Supermarkt zum Beispiel einen 50-Euro-Gutschein. Diesen können sie dann bei den Aktionsbündnissen gegen Bargeld tauschen.
Der Bundesregierung sind diese legalen Aktionen ein Dorn im Auge. Im Koalitionsvertrag kündigte sie an, solche Umgehungen der Bezahlkarte zu beenden. Konkrekte Maßnahmen würden geprüft, ließ die Regierung im Sommer verlautbaren. Für GFF-Juristin Lincoln ist hingegen klar: »Tauschaktionen sind nicht strafbar – für niemanden. Und sollte ein Gesetz zur Kriminalisierung kommen, werden wir dabei unterstützen, juristisch dagegen vorzugehen.«
Im Oktober trafen sich Initiativen und Organisationen aus dem ganzen Land in Berlin, um zu besprechen, wie der Widerstand gegen die Bezahlkarte fortgesetzt werden kann. »In Zukunft wollen wir uns darauf konzentrieren, Betroffene noch besser über die Bezahlkarte aufzuklären und diese stärker in den Widerstand dagegen einzubinden«, sagt Mitorganisator Adam Bahar vom Flüchtlingsrat Berlin dem »nd« und kündigte neue Formen des Protests an. Er betont: »Die Bezahlkarte betrifft nicht nur Geflüchtete – es gibt bereits konkrete Pläne, sie auch auf weitere von Armut betroffene Menschen auszuweiten«. In Hamburg denkt der Senat schon offen darüber nach, auch andere Sozialleistungen über eine Bezahlkarte abzuwickeln.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.