- Politik
- Friedensprozess
Türkei und PKK: Verschleppter Dialog
Die Gespräche zwischen der PKK und der türkischen Regierung kommen nicht voran
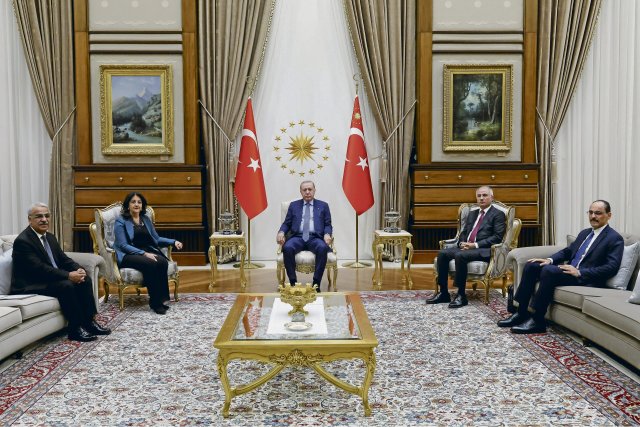
Auch über ein Jahr nach dem Beginn des Dialogprozesses zwischen der türkischen Regierung und der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) geht dieser nur schleppend voran. Eine ursprünglich für letzten Donnerstag angesetzte Sitzung der parlamentarischen Kommission für nationale Solidarität, Geschwisterlichkeit und Demokratie wurde am Mittwoch schon zum zweiten Mal verschoben. Grund dafür ist dieses Mal der bislang ungeklärte Absturz einer türkischen Militärmaschine in Georgien.
Dabei hätte die Kommission dieser Tage so einiges zu besprechen. Die jetzt erneut auf unbestimmte Zeit verschobene Sitzung war vermutlich auch deshalb eigentlich sehr hochkarätig besetzt gewesen. So war geplant, Innenminister Ali Yerlikaya, Verteidigungsminister Yaşar Güler und Geheimdienstchef İbrahim Kalın anzuhören, nachdem die PKK schon vor etwa zweieinhalb Wochen erklärt hatte, ihre verbliebenen bewaffneten Einheiten aus dem türkischen Staatsgebiet abzuziehen. Ein Schritt, der auch schon beim Friedensprozess zwischen 2013 und 2015 ein zentraler Wendepunkt gewesen war.
Seit der Rückzugserklärung waren innerhalb der Türkei erneut die Diskussionen über mögliche Amnestien für PKK-Kämpfer*innen ausgebrochen. Sabri Ok, Mitglied des Exekutivrats der Gemeinschaft der Gesellschaften Kurdistans (KCK), der die Erklärung am 26. Oktober auf einer Pressekonferenz verlesen hatte, erklärte, dass konkrete politische und rechtliche Schritte nicht weiter aufgeschoben werden dürften.
Cemil Bayık, ebenfalls Teil des KCK-Exekutivrats und PKK-Gründungsmitglied, ergänzte die Forderung wenige Tage später in einem Interview mit der kurdischen Nachrichtenagentur ANF. Es brauche konkrete rechtliche Garantien und demokratische Rechte, um die Schritte von kurdischer Seite abzusichern. »Wird es möglich sein, in der Türkei freie, demokratische Politik zu betreiben? Können die Menschen, die die Waffen niedergelegt haben, zurückkehren und sich frei politisch organisieren?« Diese Frage sei bislang weiter ungeklärt.
Trotz vermeintlichem Friedensprozess ist die Justiz in der Türkei weiter vor allem politisches Repressionsmittel der Regierung unter Recep Tayyip Erdoğan.
Inwieweit die Türkei tatsächlich bereit ist, sich darauf einzulassen, die Rückkehr von PKK-Mitgliedern in die Türkei zu ermöglichen, ist unklar. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte nach dem Rückzug unter Berufung auf »einen hochrangigen Beamten aus dem Nahen Osten und eine Quelle aus einer kurdischen Partei« berichtet, die Türkei bereite ein Gesetz vor, das die Rückkehr von etwa 9000 Personen aus dem Nordirak ermöglichen soll.
Etwa 1000 hochrangige PKK-Mitglieder sollen demnach in ein nicht näher genanntes europäisches Land gebracht werden. Ob die PKK sich mit einem solchen Gesetz abspeisen lassen würde, ist mehr als fraglich. Gerade eine fehlende Amnestie oder konkrete Demokratisierung würden einen solchen Vorschlag wohl kaum akzeptabel machen. Laut Reuters sehe das Gesetz vor, dass die Rückkehrer*innen einzeln überprüft würden. Eine Strafverfolgung wegen möglicher Straftaten sei dabei weiter möglich.
Für die allermeisten der PKK-Mitglieder dürfte das keine Option sein. Trotz vermeintlichem Friedensprozess ist die Justiz in der Türkei weiter vor allem politisches Repressionsmittel der Regierung unter Recep Tayyip Erdoğan. Dass sich daran nichts geändert hat, zeigen zwei jüngste Beispiele: Am Dienstag hatte die Staatsanwaltschaft mehr als 2000 Jahre Haft für den ehemaligen Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoğlu, gefordert. Seine Partei, die Republikanische Volkspartei (CHP) wies diese Forderung als »politische Propagandaschrift« zurück. »Mit dieser Anklageschrift hat die Regierung offenbart, dass sie dieses Land der Demokratie entreißen will«, sagte CHP-Sprecher Deniz Yücel in Ankara. Es handele sich nicht um einen juristischen Text, sondern um einen politischen, der es auf die gesamte Partei abgesehen habe. Imamoğlu gilt als aussichtsreicher Gegner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan.
Der zweite Fall betrifft das Schicksal des Ende 2016 verhafteten kurdischen Politikers Selahattin Demirtaş. Vor zehn Tagen hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg endgültig dessen Freilassung angeordnet und einen Einspruch der Türkei zurückgewiesen. Auch wenn sich selbst einstige politische Erzfeinde von der ultranationalistischen MHP für seine Freilassung aussprachen, scheint sich die Justiz dem bindenden Urteil des EGMR weiter zu verweigern. Dass sich unter solchen Umständen Tausende PKK-Mitglieder, die teilweise am bewaffneten Kampf gegen die türkische Armee teilgenommen haben, freiwillig einer solchen Justiz ausliefern werden, ist kaum zu erwarten.
Politischer Wille zur Veränderung dürfte sich auch daran festmachen, ob sich eine Mehrheit der Parlamentskommission durchringen kann, dafür zu stimmen, den PKK-Gründer Abdullah Öcalan selbst anzuhören. Diese Forderung hatten MHP, DEM-Partei und PKK neben gesetzlichen Veränderungen immer wieder als wichtigen Schritt bezeichnet. Auch diese Frage dürfte bei der kommenden Sitzung, wann immer sie stattfinden soll, Thema sein.
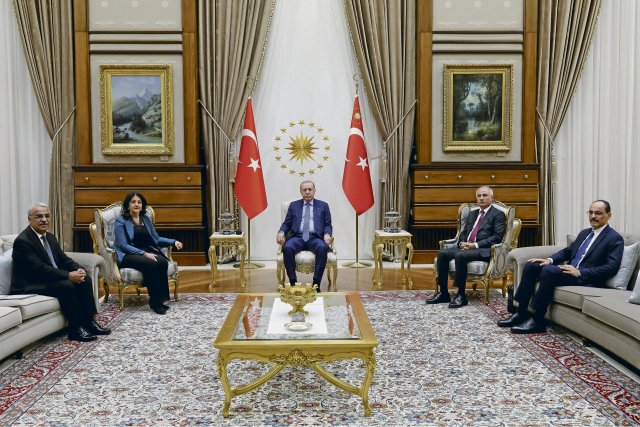
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.






