»Wer macht überhaupt das Geld?«
Die Juristin Katharina Pistor spricht über die herrschende Geldordnung und über die Frage, wer von dem System profitiert

Frau Pistor, Sie haben die diesjährigen Adorno-Vorlesungen am Frankfurter Institut für Sozialforschung (IfS) zur Neuordnung des Geldwesens gehalten. Warum interessieren Sie sich als Juristin für das Geld?
Weil der Kapitalismus ein System ist, das es strukturell ermöglicht, soziale Ressourcen dazu zu nutzen, um private Macht und privaten Reichtum aufzubauen. Und die beiden wichtigsten sozialen Ressourcen beziehungsweise Systeme sind das Rechtssystem und das Geldsystem. Ich stelle daher die Frage: Wer macht überhaupt das Geld, wer profitiert davon und welche Rechtskonstrukte ermöglichen das?
Gegenüber dem Institut, an dem Sie ihre Vorlesungen gehalten haben, hing ein Plakat des Onlinebrokers XTB: »Geld. Arbeitet es schon für dich?« Was sagen Sie zu solch einer Botschaft?
Selbst wenn Geld arbeiten könnte, bliebe die Frage: für wen? Mit dem »für dich« wird suggeriert, das Geld könnte für jeden arbeiten. Das ist jedoch nicht so. Eine Geldverfassung, die für uns alle arbeitet, müsste erst noch eingerichtet werden.
Aber das Geld ist doch grundsätzlich für alle da, jeder kann es erwerben und ausgeben?
Das stimmt in dieser Allgemeinheit. Doch ist das Geld nicht einfach »da«. Ökonomen halten das Geld oftmals schlicht für eine Sache, auf die man sich auf dem Markt geeinigt hat. Dabei ist es das Produkt einer Geldordnung und damit von politischen Kräfteverhältnissen.
Was das Geld angeht, so spielen im politischen Diskurs eigentlich nur drei Fragen eine Rolle: Wie kann es vermehrt werden – Stichwort Wachstum, Rendite, Investitionen? Wie verteilt sich das Geld – Stichwort Gewinne, Löhne, Steuern, Miete? Und schließlich der Geldwert, also Kaufkraft und Inflation. Gibt es noch mehr zu sagen? Warum spielt für Sie die Verfassung des Geldwesens so eine große Rolle?
Weil die Geldordnung der Gegenwart hierarchisch ist, sie ist auf Profit ausgerichtet und erzeugt Ungleichheit und Abhängigkeit. Meiner Meinung nach steht die geltende Geldverfassung im Widerspruch zu einer demokratischen Gesellschaftsordnung.
Was meinen Sie mit »hierarchisch«?
Das bezieht sich auf die Art und Weise, wie Geld in dieser Gesellschaft produziert wird, wie es also auf die Welt kommt. Geld wird nur zu einem geringen Teil von der Zentralbank gedruckt. Der allergrößte Teil entsteht durch die privaten Banken, sie haben das Privileg der »Geldschöpfung« und sie verdienen gut daran. Das ist schon bemerkenswert, denn Geld ist ein Produkt der Allgemeinheit, es wird durch den Staat gestiftet und braucht soziale Akzeptanz. Den privaten Banken ist es exklusiv gestattet, dieses Produkt der Allgemeinheit zum eigenen Nutzen zu kreieren.
Wie geschieht das? Wie wird Geld geschöpft?
Durch die Kreditvergabe. Es gibt häufig die Vorstellung, Banken seien reine Geldsammelstellen, zu denen Menschen ihre Euros tragen, die sie gerade nicht brauchen und die diese Euros dann verleihen an jene, die Geld brauchen. Doch sind Banken weit mehr als bloße Verteiler. Wenn sie Kredite vergeben, nehmen sie nicht das Geld von Kundin A und geben es Kunde B. Stattdessen richten sie dem Kreditnehmer – also Kunde B – ein Guthaben ein, über das er verfügen kann. Die Bank hat also eine Schuld gegenüber Kunde B zur Auszahlung der Kreditsumme. Gleichzeitig bucht sie für sich selbst eine Forderung an Kunde B auf Rückzahlung des Kredits inklusive Zins nach Ende der Kreditlaufzeit. Die Summe, die Kunde B gutgeschrieben wurde und die die Bank ihm nun schuldet, ist »geschöpft«, sie war vorher nicht da. Jede Kreditvergabe der Bank entspricht einer Produktion neuer Zahlungsfähigkeit: Buchgeld ist eine besondere Schuld, die durch ein vertragliches Verhältnis zwischen einer Bank und ihrem Kunden entsteht.
Aber ich kann Ihnen doch auch 100 Euro leihen und mir eine Forderung auf Rückzahlung in die Bücher schreiben?
Natürlich. Aber Sie haben keine Banklizenz. Daher müssen Sie die 100 Euro auch haben, um sie mir zu geben. Das ist erstens keine Geldschöpfung, sondern nur ein Tausch einer Banknote. Zweitens: Basis der Geldschöpfung der Banken sind die Einlagen der Kunden – also die Schulden, die die Bank bei ihren Kunden hat. Auf Basis dieser Schulden kann die Bank dann ein Vielfaches davon als Kredit vergeben und damit neue Zahlungsfähigkeit produzieren. Eine 100-Euro-Note kann man nur einmal verleihen – die Bank dagegen kann auf Basis ihrer Einlagen ein Vielfaches davon verleihen und damit Geld neu schöpfen.
Wenn die Bank Geld schöpft, geht sie also lauter Schuldverhältnisse gegenüber ihren Kreditnehmern ein. Solange ihre Kunden nicht die Bank stürmen und ihre Konten räumen, geht die Sache ja erst mal gut. Wo ist dann das Problem an der Sache?
Zum einen ist es keine Notwendigkeit, sondern eine politische Entscheidung, dem privaten Bankgewerbe die Kontrolle über die Geldschöpfung zu übereignen – eine Kontrolle, die den Banken Unsummen an Zins- und Zinseszinseinnahmen beschert. Ihre Geschäfte können die privaten Institute übrigens nur machen, weil hinter ihnen die Zentralbank steht, die ihre Forderungen in »echtes« Geld tauscht und damit die private Geldschöpfung quasi beglaubigt. Zum anderen führt die Freiheit der Privaten zur Kreditvergabe und damit Geldschöpfung mit großer Regelmäßigkeit zu Finanzkrisen, da die Banken weniger die Stabilität des Gesamtsystems im Blick haben als ihre Profite, prinzipiell also einen Anreiz haben, Kreditvergabe und Geldschöpfung maximal auszudehnen...
… wobei der Staat ihnen allerdings Grenzen setzt.
Ja, aber diese sind weit gefasst – zu weit, wie die Finanzkrisen zeigen. Und wenn die Krise da ist, dann ist es abermals die Allgemeinheit in Form von Staat und Zentralbank, die die Banken retten muss, weil das Geld der Gesellschaft von den privaten Kreditgeschäften abhängig gemacht worden ist. Man kann sagen: Der Staat ist es, der das Geld schafft, also zum Beispiel den Euro als Zahlungsmittel setzt. Dieses Monopol des Staates aber leiht er quasi den privaten Banken für ihre Geschäfte. Er liefert den Rohstoff, die Währung, den Euro, den die Banken dann profitabel schöpfen können und dadurch die gesamte Gesellschaft in Schuldverhältnisse zu sich bringen – übrigens nicht zuletzt den Staat selbst, der beim Finanzgewerbe Kredit nimmt. So viel zur Frage »Für wen arbeitet das Geld?«
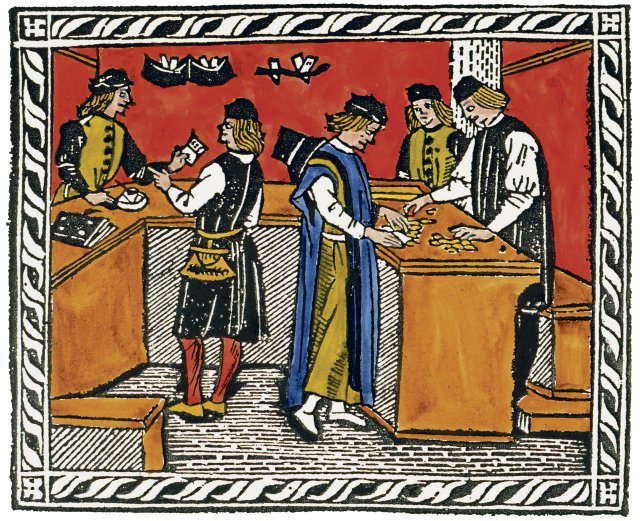
Sie sagen, Geld entsteht in Form von Buchgeld, das die Banken per Kreditvergabe schöpfen. Für jeden Kredit werden aber auch Zinsen fällig. Das bedeutet, dass jeder Euro, der in die Welt kommt, als Schuld geboren wird, als Anspruch auf Zinsen, also auf Vermehrung der geliehenen Summe. Gewinn und Wachstum sind jedem Euro in seinem Ursprung »eingeschrieben«.
Das meine ich, wenn ich sage, die Geldordnung der Gegenwart ist auf Profit ausgerichtet.
Dann entspricht aber doch die herrschende Geldordnung der Wirtschaftsordnung? Oder anders gefragt: Ist die herrschende Form der Geldschöpfung, die von Anfang an den Profit in sich trägt, nicht passend für eine kapitalistische Produktionsweise, in der also alle Arbeit und Produktion und Verteilung davon abhängig gemacht ist, dass sie einen Überschuss über die investierte Geldsumme erzielen? Geld wird vielleicht nur für Profit »produziert« – aber das gilt für Autos und Brot auch.
Aber Geld ist eben nicht nur ein Gut unter vielen. Es ist »das« Gut, der Zugang zu allen anderen Gütern, es formt soziale Beziehungen. Deswegen ist die Geldverfassung entscheidend, also die Ordnung, nach der das Geld und der Zugang zu ihm organisiert ist. Und im herrschenden System sind die Banken zur Geldschöpfung ermächtigt, ohne hierfür der Allgemeinheit gegenüber verantwortlich zu sein. Verbunden mit Zinsen und Zinseszinsen bereichert das Kreditgeld die Banken und vertieft die Abhängigkeit der privaten und öffentlichen Schuldner vom Finanzkapital. Ein solch feudalistisches Geldverhältnis halte ich für unvereinbar mit den Grundwerten einer demokratischen Ordnung. Geld muss neu gedacht und konstituiert werden.
Was tun?
Es hat in der Vergangenheit andere Geldverfassungen gegeben und es ließen sich auch neue Formen der Geldschöpfung und -verteilung denken – Formen, bei denen der Einsatz des Geldes nach anderen Kriterien demokratisch entschieden wird. Es gibt zum Beispiel das Konzept des »Billig-Geldes«, bei dem Geld nicht durch Kreditvergabe entsteht, sondern als Schenkung durch Deposit Creating Institutions. Es wäre ein Buchgeld ohne Rückzahlungsanspruch, ohne Schuldverhältnis. Banken wären in diesem System reine Finanzintermediäre, also Geldverteiler.
Das geschenkte Billig-Geld wäre also quasi ein Anrechtsschein, der zugeteilt wird gemäß demokratischen Entscheidungen, zur Finanzierung von Konsum und Investitionen, die gesellschaftlich erwünscht sind. Wäre das dann noch Kapitalismus? Wären Profit und Wachstum noch das treibende Motiv der Geldzuteilung?
Ich habe nichts prinzipiell gegen Märkte. Aber ich denke, dass der Staat sein Monopol auf das Geld, das er faktisch hat, gesellschaftlich nutzbringender nutzen könnte. Geld ist nicht nur eine ökonomische Frage, es ist auch ein politische.
Zu Ihren Vorlesungen in Frankfurt erschienen auch Banker und Zentralbanker. Wie haben die Ihre Ausführungen aufgenommen?
Mit Interesse. Banker arbeiten zwar im Herzen des Geldsystems und kennen sich in ihren Spezialgebieten sehr gut aus. Aber sie machen sich selten Gedanken über seine Verfassung. Aus ihrer Sicht wäre es sehr fragwürdig, Gelder quasi von oben zuzuteilen. Kredit und Geld seien eine private Sache, heißt es. Nun, das ist nicht ganz korrekt, es ist die Allgemeinheit, die das Geld institutionalisiert. Geschöpft wird es von den privaten Banken – aber ich bin mir sicher, es gibt gute Alternativen zu einem System, in dem Geld nur als zinstragendes Kapital der Banken auf die Welt kommt.
Quelle: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1195427.katharina-pistor-wer-macht-ueberhaupt-das-geld.html