- Kultur
- Nachruf
Micha Brumlik: Ein linker Kantianer
Er hatte keine Angst vor Widersprüchen. Ein Nachruf auf den Sozialphilosophen Micha Brumlik

Am vergangenen Montag starb Micha Brumlik in Berlin kurz nach seinem 78. Geburtstag. Er wurde am 4. November 1947 als Kind einer deutsch-jüdischen Familie in Davos geboren. Die Familie war vor den Nazis in die Schweiz geflohen, 1952 kehrte sie nach Frankfurt am Main zurück, wo Micha Brumlik aufwuchs.
Nach dem Abitur ging er zu einem zweijährigen Aufenthalt nach Israel. Er war als Zionist gekommen, doch aufgrund seiner Erfahrungen begriff er das Land als imperialistisch und wurde zum linken Antizionisten, änderte seine Haltung in späteren Jahren aber erneut und argumentierte für das Recht Israels auf Ausnahme vom Völkerrecht.
Nach seiner Rückkehr nach Frankfurt studierte Micha Pädagogik und Philosophie. Ich lernte ihn als einen Kommilitonen kennen, der der älteren Kritischen Theorie und der linken Fachschaft kritisch gegenüberstand. Er neigte zur analytischen Sprachphilosophie und sah sich der Hermeneutik Gadamers verpflichtet. In seiner Dissertation befasste er sich mit Kants Kritik der Urteilskraft; und er sah sich als Kantianer. Zugleich wohnte er mit linken Vertretern der Fachschaft zusammen, die an ihren marxistischen und internationalistischen Themen arbeiteten.
Jung wurde er als Professor für Erziehungswissenschaften berufen, von 1981 bis 2000 lehrte er an der Universität Heidelberg; danach an der Universität Frankfurt. Mit der marxistischen neuen Linken in Frankfurt konnte er nicht so viel anfangen. Aber er war bereit, Mitte der 70er Jahre für die Gründung einer linkssozialistischen Partei einzutreten, des Öfteren trafen wir uns deswegen in seiner Wohnung auf der Körnerwiese.
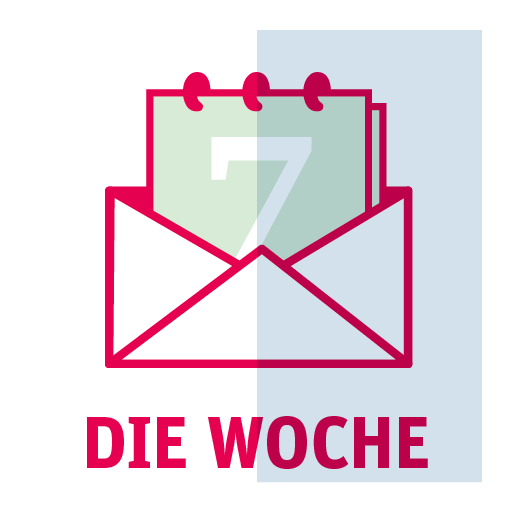
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Er engagierte sich im Sozialistischen Büro und war über viele Jahre Mitglied der Redaktion von dessen Zeitschrift »links«. Von 1989 bis 2001 war er für die Grünen Stadtverordneter in Frankfurt, beschäftigte sich mit der Kulturpolitik und widersetzte sich den Sparzwängen. Er sah sich als Liberalen und Sozialisten, konnte aber auch schon einmal entschieden für die Notwendigkeit des Kommunismus argumentieren.
Micha hatte keine Angst davor, mit Widersprüchen zu leben, auch nicht mit eigenen. Wenn man ihn privat traf, konnte er einschüchternd schüchtern sein. Doch wenn er öffentlich sprach – in Seminaren, bei Vorträgen, im Kolloquium von Jürgen Habermas, in der Kneipe – sprach er mit leicht frankfurtischem Zungenschlag klar, deutlich und laut. Er konnte, auch wenn etwas ungeduldig, zuhören und nachdenklich sein, er vertrat energisch und streitlustig seine Thesen. Er wusste, dass er provozierte und tat dies mit Nachdruck und Leidenschaft. Auch in Kontroversen mit engen Freunden. Des Öfteren habe ich ihn erlebt, wie er mit seinem langjährigen Freund Hauke Brunkhorst heftig und mit Jürgen Habermas nach dessen Kolloquien in der Kneipe geduldig stritt. Das hatte was, auch etwas von Welttheater im Kleinen, denn immer ging es um die großen Themen: Aufklärung, Universalismus, die Rechtsentwicklungen in Deutschland, Demokratie, Antisemitismus, Erinnerungskultur.
Micha Brumlik war ein unglaublich aktiver Intellektueller: als Wissenschaftler, als Leiter des Fritz-Bauer-Instituts, als Politiker, als Publizist. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher, regelmäßig in Fachzeitschriften, in Zeitungen, in »links« und in den »Blättern für deutsche und internationale Politik«, zu deren Herausgeberkreis er lange Jahre gehörte. Hier argumentierte er, Marx sei in der »Judenfrage« antisemitisch gewesen.
Die Frage, Jude in Deutschland zu sein, war ein ständiges Thema von Micha. Er war eine maßgebliche Stimme und trug streitbar zur Orientierung und Sensibilität für Judenfeindschaft bei. Mit Freund*innen aus der Jüdischen Gruppe, zu der Dan Diner, Cilly Kugelmann, Martin Löw-Beer gehörten, gründete er die Zeitschrift »Babylon«. Als praktizierender liberaler Rabbi hatte er Konflikte mit der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Er engagierte sich in stadtöffentlichen Diskussionen gegen Antisemitismus und trat für die Bewahrung jüdischer Traditionen ein.
Der Antisemitismus in der Linken war auch ein Thema für Brumlik, deswegen verließ er die »links«-Redaktion und die Grünen, viele seiner Schriften waren Analysen der Judenfeindschaft in der deutschen Geistesgeschichte gewidmet. Auf den Zusammenhang von Antisemitismus und Feindseligkeit gegenüber Migrant*innen und Geflüchteten wies er früh hin und trat gerade deswegen entschieden für Universalismus und Offenheit ein.
Wenn er Israel gefährdet sah, neigte er manchmal zu bellizistischen Positionen, sein Urteil war parteilich schnell, vielleicht auch zu schnell. Aber er konnte auch zurücktreten und seine Urteile revidieren. In der internationalen Debatte über eine Definition von Antisemitismus trat er für die »Jerusalem Declaration« ein. Entschieden wandte er sich kritisch gegen den Beschluss des Bundestages im Mai 2019 zum BDS als antisemitischer Bewegung. Dieser Beschluss hat informelle und formelle Ausladungen zur Folge, wenn Wissenschaftler*innen oder Publizist*innen des Antisemitismus nur deswegen verdächtigt wurden, weil sie BDS unterstützen. Eine entsprechende Politik bezeichnete Micha Brumlik energisch als »neuen McCarthyismus«.
Seine Krankheit hat Brumlik daran gehindert, sich an den Debatten zu beteiligen, die die deutsche Öffentlichkeit seit dem Massaker an jüdischen und nicht-jüdischen Menschen in Israel, der Geiselnahme durch Hamas und dem Krieg in Gaza bewegte. Seine Stimme, seine Analysen haben in den vergangenen Jahren gefehlt und werden in Zukunft noch mehr fehlen.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.







