- Politik
- Häusliche Gewalt
Wie sich Intimizide verhindern lassen
Ein neues Instrument soll das Risiko für Tötungen innerhalb von Partnerschaften besser abschätzen

369, 390, 411. So viele Menschen wurden in den Jahren 2021, 2022 und 2023 von ihren damaligen oder ehemaligen Partner*innen getötet oder wurden Opfer eines Tötungsversuchs. Seit Jahren bewegt sich diese Zahl auf einem ähnlichen Niveau, zuletzt ist sie sogar leicht angestiegen. Wie können solche sogenannten Intimizide verhindert werden?
Auf dem Fachtag der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt (BAG TäHG) stellte die Psychologin Rebecca Bondü von der Psychologischen Hochschule Berlin ein neues Instrument vor. Es soll das Risiko für einen Intimizid besser vorhersagen als bestehende Fragebögen, mit denen Polizist*innen, Psycholog*innen und Sozialarbeiter*innen die Gefahr abschätzen.
Mit Intimiziden sind all jene Morde gemeint, die in (ehemaligen) Partnerschaften geschehen. In Deutschland sind rund 20 Prozent der Opfer Männer. Deshalb ist es in diesem Zusammenhang ungenau, ausschließlich von Femiziden zu reden – also der Tötung einer Frau oder eines Mädchens aufgrund ihres Geschlechts.
Ein Großteil der Femizide ist der häuslichen Gewalt zuzuordnen, neben der Partnerschaftsgewalt zählen dazu auch Gewalttaten in der Familie, unabhängig von einem gemeinsamen Haushalt. 2023 wurden laut Bundeskriminalamt 938 Mädchen und Frauen Opfer von versuchten oder vollendeten Tötungsdelikten.
Im Rahmen von Täterarbeitsprogrammen sollen sich Gewalt ausübende Menschen, meist Männer, mit den Ursachen von (geschlechtsspezifischer) Gewalt auseinandersetzen und lernen, in Zukunft friedlicher zu handeln.
Dieses »Risikoanalyseinstrument für Intimizide«, abgekürzt Gate-Rai, stützt sich vor allem auf ein Konzept aus der Terrorbekämpfung: »Leaking« heißt auf Deutsch »lecken« und bezeichnet Äußerungen oder Handlungen, mit denen potenzielle Täter*innen ihre Absicht öffentlich zu erkennen geben – die mörderischen Pläne schlagen gewissermaßen Leck.
Beispiele dafür finden sich in Medienberichten über Intimizide immer wieder: Der Mann, der Tage vor der Tat einem Freund sagt, er werde für »15 Jahre ins Gefängnis« gehen. Die Online-Suche nach dem Tod durch Schlafmittel. Die Drohung: »Schlagen ist noch gar nichts, ich kann dich auch töten.«
Um zu untersuchen, welche Rolle diese mehr oder weniger bewussten Vorausschauen bei der extremsten Form der Partnerschaftsgewalt spielen, analysierte das Team um Bondü knapp 80 Ermittlungsakten zu Intimiziden. In etwas mehr als der Hälfte der Fälle fand es Hinweise darauf.
Deren Beitrag zur Risikoanalyse ist mitunter überraschend. »Bedrohungen des späteren Opfers sind die häufigste Form des Leakings«, so Bondü. »Doch wenn man das Risiko eines Intimizids einschätzen möchte, ist die bloße Häufigkeit kein guter Indikator – schließlich werden weit mehr Drohungen ausgesprochen, als Intimizide tatsächlich verübt werden.«
Ähnlich verhalte es sich mit häuslicher Gewalt. Diese sei zwar weit verbreitet, führe aber nur in den seltensten Fällen zu einem Intimizid. »Umgekehrt zeigt sich: Betrachtet man ausschließlich vollendete Intimizide, gab es in vielen Fällen zuvor keine bekannten Anzeichen häuslicher Gewalt«, sagt Bondü. »In unseren Daten liegt dieser Anteil bei etwa 40 Prozent.«
Wichtig ist dabei: Die Dunkelziffer bei häuslicher Gewalt ist sehr hoch, in vielen Fällen melden Betroffene von Gewalt durch ein*e Partner*in diese nicht, sei es aus Angst, Scham oder Abhängigkeit. Folglich tauchen viele Taten auch nicht in Ermittlungsakten auf.
Doch wenn direkte Drohungen oder vergangene Gewalttaten für die Risikoeinschätzung eines Intimizids nicht zentral sind, was dann? »Eine bessere Vorhersagekraft haben seltenere Formen des Leakings, wie beispielsweise die Ankündigung einer Tat gegenüber Dritten oder Tatrechtfertigungen«, sagt Bondü.
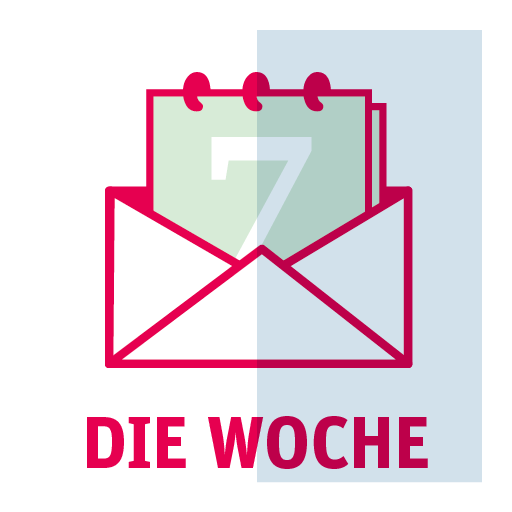
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Um herauszufinden, welche Vorkommnisse für die Risikoanalyse wichtig sind, verglich das Team um Bondü die ursprünglichen Ermittlungsakten mit Fällen, in denen eine Tat zwar angekündigt, aber nicht ausgeführt wurde. Mit Gate-Rai gelang es, über 80 Prozent der späteren Täter*innen mit einem erhöhten Tatrisiko und ebenfalls über 80 Prozent der späteren Nicht-Täter*innen mit einem geringen Tatrisiko in Verbindung zu bringen.
Dieser Wert kam aber nicht nur durch die Analyse von Leakings allein zustande. In dem neuen Instrument spielen auch sogenannte Trigger eine Rolle, damit sind besonders belastende Ereignisse gemeint. Ein typisches Beispiel: der Moment, in dem einem Mann die Trennung von seiner Frau bewusst wird, etwa wenn Scheidungspapiere im Briefkasten landen, oder er die ehemalige Partnerin mit einem neuen Partner sieht. Auch weitere Warnsignale wie neu auftretende psychische Probleme sind wichtig.
Wenn es ausschlaggebend ist, ob jemand gegenüber einem Nachbarn einen Mord rechtfertigt, ob er sich aus seinem sozialen Umfeld zurückzieht, oder ob Familienangehörigen Suchbegriffe im Browser-Verlauf auffallen, dann muss ein erweiterter Personenkreis hinzugezogen werden, um Intimizide zu verhindern.
Seit Langem fordern sowohl Opferschutz- als auch Täterarbeitsorganisationen, dass Risikoeinschätzungen im Rahmen von sogenannten Fallkonferenzen getroffen werden. Dabei kommen verschiedene Akteure an einem Tisch zusammen und teilen Informationen. Neben der Polizei können das auch Beratungsstellen, Frauenhäuser und Jugendämter sein. Tools wie Gate-Rai erlaubten, bei solchen Fallkonferenzen Informationen zu teilen, ohne sensible Daten preisgeben zu müssen, meint Bodü. Trotz ihrem Nutzen sind Fallkonferenzen bundesweit noch immer eine Seltenheit.
Die BAG TäHG wäre da gerne schon weiter. Auf ihrem Fachtag begrüßte sie auch die Psychologin Gill McKinna aus Schottland. Diese leitet dort das »Caledonian System«, in dem die Prävention von Gewalt von Männern an Frauen ganzheitlich angegangen wird: Ein gerichtlich angeordnetes Täterprogramm geht dabei automatisch mit einem Unterstützungsangebot für Frauen und Kinder einher. Dieser systemische Ansatz – die Arbeit mit der gesamten Familie – soll das Risiko weiterer Gewalt reduzieren. Laut der schottischen Regierung läuft das Caledonian System derzeit in 21 von 32 Verwaltungsbezirken und deckt damit 70 Prozent der Bevölkerung ab. In Deutschland ist man davon noch weit entfernt.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.






