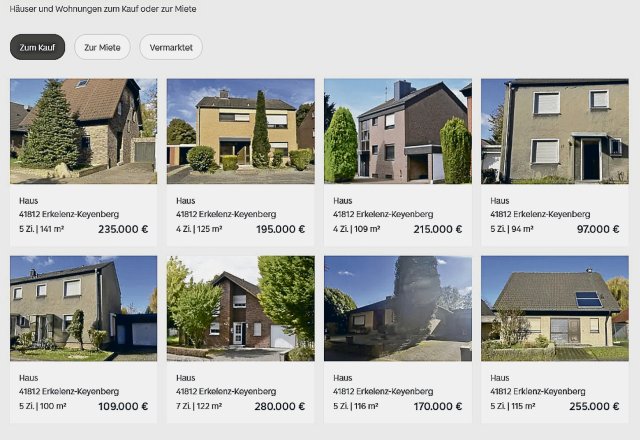- Politik
- Tag der Menschenrechte
»Hat man solche Partner, darf man nicht pessimistisch sein«
Tsafrir Cohen, Geschäftsführer von Medico International, zur Bedrohung der Menschenrechte weltweit

Der 10. Dezember ist der Internationale Tag der Menschenrechte. Was bedeutet dieser Tag für dich?
Man müsste den 10. Dezember eigentlich den Tag der größten Heuchelei nennen. Denn derzeit werden die Menschenrechte und mit ihnen auch die internationalen Institutionen von Donald Trump und der globalen radikalen Rechten täglich untergraben. Um nur ein Beispiel zu nennen: Die obersten Richter des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag sind mit Sanktionen belegt und verfügen über keine Bankkonten mehr. In vielen Ländern können Menschenrechtsorganisationen kaum mehr arbeiten, ihre Mitarbeiter*innen sind auch privat extrem gefährdet.
Hinzu kommt: Die alte, liberale Ordnung hat die Menschenrechte zum Werkzeug des Westens gemacht, um ihre Interessenpolitik zu verschleiern und die eigene Herrschaft zu sichern. Das ist die eine Seite.
Es gibt aber auch eine andere Seite. Denn die Diskursgeschichte seit der Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember 1948 zeigt, dass die Menschenrechte auch eine ganz andere Funktion besitzen. In den Jahrzehnten nach deren Verkündung waren es gerade die eben noch kolonisierten Staaten, die die Erweiterung und Verrechtlichung der Menschenrechte vorantrieben. Sie setzten sich vor allen Dingen für kollektive Rechte ein, wie sie etwa im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte zum Ausdruck kommen. Sie erhofften sich davon eine gerechtere Gestaltung der Welt. Der neoliberale Vormarsch hat jedoch ab den 80er Jahren dazu beitragen, Menschenrechte nur noch als individuelle statt kollektive Rechte zu verstehen.

Tsafrir Cohen ist Geschäftsführer von Medico International. Bis 2014 war er hier für Projektkoordination und Öffentlichkeitsarbeit zu Israel und Palästina zuständig. Danach hat er bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung Regionalbüros geleitet: zunächst in Israel, dann in Großbritannien und Irland.
Was bedeuten Menschenrechte denn in Bezug auf eine solidarische Praxis?
Den zahlreichen Menschen, die an der Realität verzweifeln und sich von den Menschenrechten verabschieden, entgegnen beispielsweise unsere südafrikanischen Partner*innen, das juristische Rüstzeug der Menschenrechte sei die letzte Bastion der Marginalisierten gegen die Mächtigen, gegenüber Staat und Wirtschaft.
Rechte werden nie verschenkt, sondern stets durch einen Prozess der Aushandlung, der Organisierung und Mobilisierung von Aktivist*innen und breiten Bevölkerungsschichten erkämpft. Aber wir müssen verstehen, dass Menschenrechte gesellschaftlichen Rückhalt benötigen. Sie sind immer nur so viel wert, wie es dieser Rückhalt hergibt. Es geht also um Solidarität und Widerstand. Diese zwei fundamentalen Begriffe sind aus unserem Diskurs über Menschenrechte verschwunden. Sie gehören wieder dorthin.
Wir müssen uns zugleich darüber im Klaren sein, dass Widerstand und Solidarität auch etwas kosten. Menschen gehen ins Gefängnis dafür, riskieren ihr Leben oder das ihrer Liebsten. Andere geben etwas ab, indem sie beispielsweise aus dem reichen Norden Gelder spenden in den Süden – das ist ebenfalls eine Form von Solidarität. Ich würde die individuelle Geste auch nicht kleinreden. Solidarität ist heute auch ein Beziehungsaufbau zwischen Ungleichen, um ein neues soziales Miteinander zu ermöglichen, im Kleinen wie im großen Ganzen.
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung unterhält mehr als zwei Dutzend Auslandsbüros auf allen Kontinenten. Im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit »nd« berichten an dieser Stelle regelmäßig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Entwicklungen in den verschiedensten Regionen. Heute: Brics-Plus. Alle Texte auf: dasnd.de/rls
Du schreibst im »Medico-Rundschreiben« über die Idee einer »radikalen Zeugenschaft«. Was meinst du damit?
Radikale Zeugenschaft bedeutet, sich von der real existierenden Machtlosigkeit angesichts der gegenwärtigen Kriege, der Ausgrenzung und des Massenmordens unserer Zeit nicht beugen zu lassen. Wir werden nicht wegschauen, nur weil das weniger angreifbar macht. Wir dürfen uns vor allem auch dann nicht ohnmächtig abwenden, wenn wir gegenwärtig keine Mehrheiten für das universelle Versprechen von Freiheit und Gleichheit generieren können.
Wo liegt hier der Zusammenhang zur internationalen Solidarität?
Mit Blick auf die Solidarität muss man mehrere Ebenen unterscheiden. Da gibt es etwa die Solidargemeinschaft der Familie, die enorm wichtig ist – insbesondere in jenen Ländern, in denen es keine sozialen Sicherungssysteme gibt. Der Preis hierfür sind Patriarchat und Kirche. Die Sicherungssysteme wiederum verweisen auf die nationalstaatliche Solidargemeinschaft, die weit über die unmittelbaren Beziehungen der Menschen hinausgeht. Das ist eine zweite, abstrakte Ebene, auf der man für bessere Gesetze und Institutionen kämpfen kann. Der Preis hierfür sind Nationalismus und Grenzregime.
Möchten wir dies überwinden, so benötigen wir eine dritte, internationale Ebene. Diese gibt es leider noch nicht. Wir haben bei Medico lange darüber nachgedacht, wie ein internationales Gesundheitssystem aussehen könnte. Aber das Problem ist, dass es keine internationalen Institutionen gibt, die das gewährleisten können. Die Uno unternimmt hier Anstrengungen, die aber nicht ausreichen und zudem massiv angegriffen werden.
Medico wurde 1968, inmitten des Kalten Krieges, gegründet. Es ging damals um Solidarität mit den Befreiungsbewegungen im Globalen Süden. Heute, in Zeiten der Multipolarität, müssen wir Solidarität neu denken und praktizieren. Wie genau diese aussehen kann, müssen wir in einem gemeinsamen Suchprozess, hier wie in der Welt, ergründen und erproben.
Du hast ja bereits betont, dass Solidarität nicht einfach gegeben ist, sondern erkämpft werden muss. Wie schätzt du die Lage dafür derzeit ein?
Zunächst einmal müssen wir konstatieren, dass wir in der Defensive sind – global, kontinental und national. Unser Traum von der Durchsetzung globaler Rechte als der angemessenen Form planetarischer Solidarität ist vorerst ausgeträumt. Und die nationalen Formen kollektiver Solidarität, wie jene, die im Sozialstaat institutionalisiert wurden, stehen unter Dauerbeschuss. Deshalb sind wir derzeit gezwungen, das Wenige, das wir erreichen konnten, zu verteidigen.
Wir sind in einer weitgehend machtlosen Position, und die Herausforderung liegt darin, wie Adorno schrieb, sich »weder von der Macht der anderen, noch von der eigenen Ohnmacht dumm machen zu lassen«. Wir dürfen nicht hinnehmen, dass im deutschen Fernsehen die Schrecken des Gaza-Krieges nicht gezeigt werden, dass auch in den TV-Bildern aus der Ukraine nicht sichtbar wird, was für ein Gemetzel dort stattfindet, mit täglich 1500 Toten und Schwerverletzten, seit bald vier Jahren.
Im Falle Palästinas haben wir mit der Organisierung einer Kundgebung Ende September in Berlin ein Zeichen gesetzt. Es geht darum, Räume zu schaffen, in denen auch die durch die sogenannte Staatsräson unterdrückten Stimmen zu Wort kommen und eine breitere Öffentlichkeit erreichen können. Wir waren 100 000 gegen den Genozid. Das ist ebenfalls Teil radikaler Zeugenschaft.
Ja, Demonstrationen zu organisieren, ist ja nicht das Tagesgeschäft bei Medico. Kannst du ein paar weitere Beispiele nennen, wie Solidarität für euch konkrete politische Praxis sein kann?
Wir sind seit Jahrzehnten im Bereich Flucht und Migration tätig, haben ein riesiges Netzwerk und einen Fonds für Bewegungsfreiheit aufgebaut. Dieser Fonds soll Löcher in die Mauern der Festung Europa schlagen. Wir unterstützen Menschen, die an den Rändern Europas unrechtmäßig in Gefängnissen sitzen. Auch wenn wir dafür massiv angefeindet werden, es gilt: Migration ist kein Verbrechen.
Ein weiteres Beispiel ist die Klimaklage. Wir unterstützen 43 pakistanische Bäuerinnen und Bauern bei ihren Klagen gegen RWE und Heidelberg Materials. Hinter ihnen stehen Tausende weitere Dorfbewohner*innen, die durch den Klimawandel Hab und Gut verloren haben. Es dreht sich nicht nur um Gerechtigkeit, für uns ist ebenso die kollektive Ermächtigung der Menschen ausschlaggebend. Es war daher ein sehr berührender Moment, als eine Bäuerin erklärte, sie werde die Hälfte des Geldes im Falle ihres Sieges vor Gericht ihrer Gemeinde geben – dass sie solidarisch einsteht für die Rechte nicht nur ihrer Familie, sondern aller vom Klimawandel Betroffenen.
In den letzten zehn Jahren haben wir im Kontext von Medico und Rosa-Luxemburg-Stiftung immer wieder über das Thema Solidarität gesprochen. Wie hat sich der Diskurs verändert?
Vor zehn Jahren hatten wir noch den Eindruck, dass wir internationale Solidarität immer weiter ausbauen, dass es vorwärtsgeht. Die Weltlage hat sich verändert, wir stehen am Ende der Nachkriegsordnung. Heute werden das Recht auf Hilfe und sogar das Recht auf Leben infrage gestellt. Da hat es globale Solidarität extrem schwer.
Und was bedeutet Solidarität, wenn wir von Deutschland aus denken?
Meines Erachtens bedeutet sie beispielsweise, die Lehren aus der Shoah und die Lehren aus dem Kolonialismus nicht gegeneinander auszuspielen. Das gilt auch innerhalb Deutschlands als einer postmigrantischen Gesellschaft: die Erfahrungen von Menschen, die aus anderen Ländern stammen, mit dem Erbe und der Verantwortung der Menschen, die historisch von hier kommen, zu versöhnen. Wenn wir das nicht hinbekommen, wird es enorme Verwerfungen geben.
Darin liegt jedoch auch eine Chance. Der Historiker Michael Rothberg hat das Konzept multidirektionaler Erinnerung vorgeschlagen. Dafür muss man lediglich die Engführung überwinden und sich der Welt öffnen: der Welt in uns, als postmigrantische Gesellschaft, und jener Welt da draußen. Was nehmen wir aus der Geschichte? Wie reparieren wir, was geschehen ist? Und welche Rolle spielt dabei Solidarität? Diese Reparatur der Welt ist eine wichtige Aufgabe, und es würde uns sehr guttun, daran zu arbeiten, statt verschiedenes Leid gegeneinander auszuspielen.
Woher nimmst du angesichts der krisengeschüttelten Welt die Hoffnung?
Bei Medico kann man sich manchmal so fühlen, als hätte man die ganze Welt, in der unsere Partnerorganisationen noch in aussichtslosester Lage Solidarität praktizieren, an der Seite. Ich war seit dem 7. Oktober 2023 dreimal in Palästina und habe dort mit unseren Partner*innen gesprochen, die nichts mehr haben. Sie leben in Zelten, haben kein Essen für ihre Kinder. Und diese Menschen arbeiten immer noch als Krankenpfleger*innen, Ärzt*innen usw., und das an einem Ort, der vollkommen zerstört ist. Sie arbeiten einfach weiter, um den Menschen zu helfen. Das nenne ich Humanität.
Oder die Vertreter*innen der Herero und Nama, die seit dem deutschen Völkermord zu Beginn des letzten Jahrhunderts Reparationen fordern – und nicht aufgeben, allen Umständen zum Trotz. Sie bestehen auf ihrem Recht, es geht um ihre Würde als Menschen. Hat man solche Partner, darf man nicht pessimistisch auf die Welt schauen.
Hana Pfennig ist stellvertretende Leiterin des Bereichs Politische Kommunikation der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.