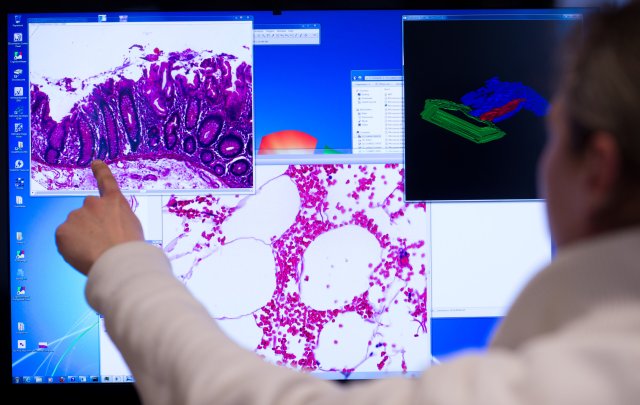Religion als Medizin?
Studien untersuchten Einfluss des Glaubens auf die Gesundheit
Die Frage, wie sich Religiosität auf die Gesundheit auswirkt, treibt die Menschen seit Langem um. Schon im Jahr 1872 untersuchte der englische Gelehrte Francis Galton, ob Kleriker seltener krank werden und länger leben. Seine Beobachtungen ergaben, dass der Glaube die Gesundheit wohl nicht fördert. Das Resultat beruhigte Galton, denn der Forscher war selbst kein frommer Mensch. Jahre später bewertete Sigmund Freud Religion sogar als etwas Krankhaftes. Der Begründer der Psychoanalyse sah darin eine kollektive Zwangsneurose und den Ausdruck des infantilen Wunsches nach dem Schutz eines übermächtigen Vaters.
Heutzutage suchen dagegen insbesondere amerikanische Wissenschaftler verstärkt nach gesundheitsdienlichen Einflüssen des Glaubens. Vor einem Jahr kamen etwa Forscher aus Philadelphia zu dem Schluss, dass ältere Kirchgänger eine bessere Lungenfunktion bewahren als nichtgläubige Senioren. Ihre Erklärung: Der Kirchenbesuch gewähre emotionalen Rückhalt, verringere soziale Isolation und fördere damit das Wohlbefinden alter Menschen.
Generell deuten auffällig viele US-Studien auf einen – wenn auch eher schwach ausgeprägten – gesundheitlichen Nutzen des Glaubens hin. Demnach sind fromme Menschen psychisch gesünder, weniger stressgeplagt, seltener depressiv und generell zufriedener. Metaanalysen zeigen sogar, dass Religiosität vor körperlichen Problemen wie Bluthochdruck und Herzerkrankungen schützt.
Solche Resultate bewertet Sebastian Murken von der Universität Trier skeptisch. »Die Qualität der Studien lässt sich kaum prüfen«, sagt der Religionspsychologe nüchtern. »Und nach negativen Effekten wird meist nicht gefragt.« Finanziert wird der Großteil solcher Untersuchungen von religiösen Gruppen wie der John Templeton Foundation. Sie wollen den Nutzen des Glaubens auf ein wissenschaftliches Fundament heben. Murken selbst schließt zwar keineswegs aus, dass Religiosität die körperliche Gesundheit beeinflussen kann – allerdings eher indirekt, etwa durch Speise- und Hygienegebote oder den Rat zur Meidung von Alkohol. Abgesehen davon gäben seriöse Studien kaum Hinweise auf eine grundsätzliche gesundheitsfördernde Wirkung des Glaubens. »Der Einfluss von Religiosität wird überschätzt«, sagt Murken. Dass Religiosität bei der Krankheitsbewältigung helfe, lasse sich in Studien nicht zeigen. »So gerne ich das präsentieren würde, wir kriegen es nirgends raus.« Zwar erleben viele Menschen, die plötzlich mit einer schweren Krankheit konfrontiert werden, ihren Glauben subjektiv als Halt gebend. »Aber deshalb geht es anderen Kranken nicht schlechter«, erläutert der Forscher. »Wer nicht gläubig ist, findet unter Umständen woanders Halt, etwa in der Familie oder in einer humanistischen Weltanschauung. Ein Jenseitsglaube an sich hat noch keine positive Qualität.« Nur im Umgang mit schweren Schicksalsschlägen, die rational nicht erklärbar seien, biete es vielleicht Vorteile, im Glauben verankert zu sein, vermutet Murken.
Negative Effekte des Glaubens werden in den meisten Untersuchungen gar nicht erst thematisiert. Dabei deuten Murkens Untersuchungen darauf hin, dass manche, meist ältere Gläubige mit einem sehr negativen Gottesbild Schicksalsschläge oder Erkrankungen als Strafe Gottes für Verfehlungen und Sünden interpretieren. Murken spricht von einer »Entmündigung in religiösem Rahmen«. Dies behindere eine selbstverantwortliche Entwicklung des Menschen und führe zu Hilflosigkeit. »Der Glaube sollte die Selbstverantwortung des Menschen nicht schmälern«, betont der Psychologe.
In den USA treibt die Diskussion um Religion und Gesundheit mitunter seltsame Blüten. So ließen Forscher der Harvard-Universität drei christliche Gruppen zwei Wochen lang für die Genesung von 1200 Patienten beten, die am Herzen operiert wurden. Die Hälfte von ihnen wusste, dass für sie gebetet wurde. Für weitere 600 Patienten gab es im Rahmen der Studie keine Fürbitten. Resultat der 2,4 Millionen Dollar teuren Untersuchung: Zumindest im Zeitraum von 30 Tagen förderten die Gebete die Genesung nicht. Lediglich in der Gruppe, die von Gebeten für sie wusste, kam es überraschenderweise häufiger zu Komplikationen. Vielleicht waren die Patienten besorgt darüber, dass ausgerechnet sie für die Gebete ausgewählt wurden, nach dem Motto: Ich bin so krank, dass sie für mich beten müssen.

Mehr Infos auf www.dasnd.de/genossenschaft
Linken, unabhängigen Journalismus stärken!
Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.
Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.