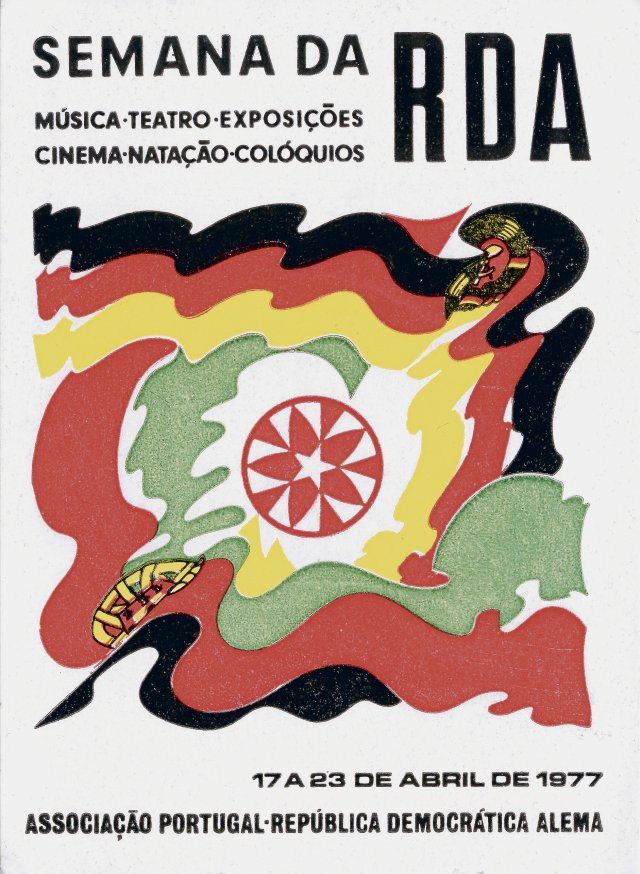Eine merkwürdige Reise nach Amerika
Klaus Walther war mit Robert aus Pennsylvania unterwegs entlang der Mulde
Dort, wo die Mulde ihren Ursprung hat, klingt es noch ganz unverfälscht vogtländisch. In den Tälern um Klingenthal und Markneukirchen musiziert man auch im Dialekt. Freilich, das ändert sich. Bald schon wird die Sprache breiter; Goethe staunte gelegentlich, dass die Sachsen b, p und t, d lediglich für zwei verschiedene Buchstaben halten. Die Gespräche fließen gemächlich dahin, so »sin ähm mir Sachsen«. Und das Land passt sich an. Oder ist es die Sprache, die den weitflächigen Gegenden entspricht? Da hatte Robert sein Thema, als wir mit ihm an die Mulde fuhren.
Einst saß er als amerikanischer GI an der Grenze zwischen West und Ost und lauschte hinein ins östliche Land. Nun wollte er sehen, was er gehört hatte.
Jetzt ist er Professor in Lancaster, mitten in Pennsylvania, nicht weit von Amish Country entfernt, wo man noch immer einen altfränkischen Dialekt pflegt. Aber mit Dialekt kann man auch in sächsischen Gefilden dienen. Und übrigens, wir sind nicht weit von Amerika entfernt. Das hielt Robert für einen freundlichen Witz, bis das Straßenschild auftauchte: Amerika. Hier, an einer alten Muldenfähre, fuhren einst die Mädchen und Frauen hinüber in die Wollspinnerei, und sie sangen, wenn man der Legende glauben darf: »Ri, ra, rutschika, wir fahren nach Amerika.«
Es ist mittlerweile hundertfünfzig Jahre her, dass der Fleck im Muldental auch den amtlichen Namen Amerika bekam. Nun, von Wolle ist nichts mehr zu sehen, und das Garn, das man hier im Gespräch spinnt, ist sächsischer Natur. Robert war entzückt, als er eben hier in Amerika eine Firma aus heimischen Gefilden ortete, die Satellitenschüsseln produzierte. Amerika in Amerika, sagte er lachend, und immer holt einem die Vergangenheit ein.
Hier also tritt die Mulde aus dem erzgebirgischen Becken ins sächsische Hügelland, hinter Wolkenburg, denn wir haben uns die ersten Kilometer geschenkt, da der Fluss aus den vogtländischen Bergen kommt. Wenn wir uns nun auf den Weg begeben, nahe dem Wasser, erkennen wir die besondere Struktur des Flusstales. Die Felswände heben sich vierzig bis sechzig Meter in die Höhe, und die Straße mäandert mühsam durch das Gestein, bis auf steilem Granitsporn unsere erste Burgenstation erkennbar ist. Rochsburg. Und Robert kann sich sein »0 very nice« nicht verkneifen.
Fast scheint das Mittelalter noch hinter den hohen Bäumen und Büschen zu leben, aber ein Parkplatz mit einem Automaten, der unseren Obolus fordert, bringt uns in die Gegenwart zurück. Ein bisschen Amerika mittlerweile auch hier, sagen wir lachend. Irgendwer hat auf dem kurzen Weg zur Burg eine Sachsenfahne aufgehängt. Wir hätten es uns denken können, dass wir noch im sächsischen Land sind, denn eine Stimme aus einer rundlichen Person ruft: »Heite is de Besichtikung der Burk ni meeglich.«
Robert lauscht, aber der Dialekt kam nicht vor in seinem Spracharchiv, denn immerhin lehrte er Deutsch an der Universität. Doch die Burg zeigt sich uns. Wie ein Bilderbuch öffnet sich das Bauwerk. In den Gärten blühen die letzten Rosen und verdorrte gelbe Stockrosen lehnen sich an die Zäune. Der Himmel schiebt sich blau über alte Bäume. Romantische Szenerie mit Amerikaner am Rande, könnte man sagen. Und da kommt auch die energische Dame wieder. »Ich hab doch gesacht, de Besichtikung is heite ni meeglich«, schwafelt es hinter uns her. Und Robert kommt sich vor wie im babylonischen Sprachengewirr.
Aber wir sind schon an der Zugbrücke, die über einen Graben springt. Alte Wackersteine massieren unsere Fußgelenke. Das ist sie also, die Rochsburg, die meistbesuchte Burg des Burgenlandes, eine gut erhaltene Schutzanlage, ein Märchenstück. 1195 wird die Burg erstmals erwähnt, und seither sind die Jahrhunderte mit Umbauten und Anbauten über das Gemäuer hinweggegangen. Der Bergfried stammt noch aus dem 12. Jahrhundert, und so reihen sich die Zeiten in den Gemäuern. In den Wirtschaftshof gelangen wir durch einen niedrigen Tunnel. Ein Wirtschaftshof ist es geblieben, hier rasten die Autos der Bauleute, der Elektriker und Maler. Eine solche Burg braucht immer Bauleute und Geld. Trotz der Unkenrufe unserer sächsischen Kassandra, wir haben telefonisch erbetenen Zutritt. Wir klettern die Wendeltreppe empor, stehen dann im Festsaal der Kemenate. Bilder von Herren und Damen, die einst hier lebten, an den Wänden – und die Fenster, die weit offen stehen und den Blick ins Freie bieten. Die schöne Aussicht von Rochsburg, sagt Robert. Und vielleicht ist sie das Beste an diesen alten Mauern, der Blick weit ins Land, eine Welt der Farben.
Nun zieht es uns wieder an die Mulde, und wir begegnen dabei der größten Brücke, die den Fluss überspannt. Die Göhrener Brücke aus der Frühzeitig der Eisenbahnen, ein Viadukt, das das Tal in 68 Meter Höhe mit 381 Meter Länge überspannt. Siebenundzwanzig Bogen und zwei Geschosse – wir Zeitgenossen ganz anderer Rekorde können das Staunen nicht verbergen. Bald schon öffnet sich das Tal und eine Ansiedlung schiebt sich an den Fluss, den wir nach der Begegnung mit zwei steinernen Herren überqueren.
Wechselburg: Aus dem Roten Porphyr der benachbarten Brüche hat der Bildhauer Karl-Heinz Richter zwei Gesellen geschlagen, die den Gebietstausch oder sagen wir besser, den »Wechsel« der Ländereien zwischen Sachsens Moritz und dem Grafen von Schönburg symbolisieren. Und hinter dem kleinen Marktplatz neben der Pfarrkirche St. Otto versteckt sich das Schönste dieser Stadt, die romanische Stiftskirche, die zwischen 1160 und 1180 unter dem Grafen Dedo von Rochlitz entstand, wie mir Robert aus seinem Reiseführer Made in USA vorliest. Der einzigartige Lettner, die Triumphkreuzgruppe, Kunstwerke von hohem Rang, sie bestimmen das Innere dieses Bauwerks aus der Stauferzeit. Doch die Kirche ist nicht nur ein Denkmal.
Roberts Akzent ist wohl unüberhörbar, und die englische Anrede aus einer Mönchskutte wechselt schnell ins Deutsche. »Ich war der erste Westmönch im Osten«, sagt Pater Rupert, der nach der Wende aus dem altbayerischen Kloster Ettal kam. Über ein paar Umwege wechselte er nach Wechselburg, wo er 1993 mit einigen Brüdern ein neues Kloster begründete, ein Kind jener bayerischen Mutter. Wechsel allenthalben, aus dem einstigen Chorherrenstift wurde ein Benediktinerkloster. Ein anderer Ton zog ein in das Städtchen, aber das Bayerische und das Sächsische vertragen sich hier gut.
Es ist still an diesem Morgen in der hohen Halle der Kirche. Da haben wir Zeit für ein stummes Gespräch mit der Kreuzgruppe aus rotem Porphyr, dem Stein dieser Landschaft. Bald sind wir auch auf dem Weg zum Ursprung dieses »sächsischen Marmors«, der uns überall an Mauern, Häusern und Kirchen begegnet. Das vulkanische Gestein schmückt nicht nur im Muldenland die Bauwerke, auch das Alte Rathaus in Leipzig, die Augustusburg haben die fleischrote Tönung des Porphyr. Und wie seit tausend Jahren wird noch immer in den Brüchen am Rochlitzer Berg der Stein gebrochen. Auch Stadt und Schloss Rochlitz leuchten in sanft glühendem Rot.
Das Schloss ist freilich eine Burg, doziert der Reiseführer aus Philadelphia, und da hat er Recht. Erste Teile entstanden schon um 995, zwei Fernwege kreuzten die Mulde, ringsum stand finster und undurchdringlich der Miriquidi. Zwei vierkantige spitzbehelmte Türme stehen nebeneinander über breite Mauern, die »Lichte Jupe« und die »Finstere Jupe«, wie sie genannt werden. Früher waren sie als Gefängnisse gefürchtet. Noch kurz nach dem zweiten Weltkrieg hatte der sowjetische Geheimdienst NKWD hier seine finsteren Gemächer, und es sollte lange dauern, ehe sich die »Jupen« (der Name ist von einer Jacke-Joppe abgeleitet) öffneten.
Im Burghof wachsen Linden und Akazien vor den hohen rauen Wänden. Steile Schieferdächer lehnen sich gegen den Himmel. Und überall sitzt der Begleiter uralter Burgenlandschaft, der Verfall, dem man mühsam zu begegnen sucht. Aber Robert sieht das anders, er sagt: »Europa, du hast es besser, deine Geschichte ist steingeworden.« Das ist ein halbes literarisches Zitat und eine ebensolche Erkenntnis. Und während wir mit dem Burgdirektor parlieren, der aus Hessen kommt, also in mancherlei Dialekten und Sprachfärbungen, suchen wir schon das nächste Ziel unserer Reise.
Eine Verbeugung vor dem Gast aus Amerika? Im Muldenstädtchen Colditz tragen die Hinweisschilder ihre Bezeichnungen in Deutsch und Englisch: »Burg/castle«. Und das Castle sitzt dann hoch oben über Stadt und Fluss. »Hello«, also und »do you speak english?», Robert ist entzückt. Aber nein, hier spricht man Deutsch oder die sächsische Lautverschiebung, die sich deutsch nennt. Unter den riesigen Gerüsten, die gestern noch die Burg wie ein Spinnennest einhüllten, sitzt in einem schmalen Kabinett die sprachgewandte Dame am Einlass. »Engländer kommen sehr oft hierher, deshalb haben wir die zweisprachigen Hinweise«, sagt sie, und Robert ist enttäuscht. Also kein Willkommen für ihn.
Schloss Colditz ist, sagen wir es ein bisschen direkt, ein riesiger Gemäuerkasten hoch über der Mulde. Erstmals urkundlich erwähnt wird das Schloss 1046 als Burgwardbezirk, und dann wie so oft: Fürsten und Kurfürsten, Kriege, Zerstörung und Verfall. Vielleicht ist die interessanteste Zeit erst ein halbes Jahrhundert vergangen: Zwischen 1939 und 1945 hatte die Wehrmacht ein Gefangenenlager eingerichtet. Hier war, wie es die Insassen ironisch formulierten, »the Bad Boys Camp«. Hierher kamen gefangene Offiziere, die in anderen Lagern schon Ausbruchsversuche unternommen hatten. Colditz galt als absolut ausbruchsicher. Aber es gab auch hier fast dreihundert Fluchtversuche, und einunddreißig Männern glückte die Flucht. 1944 gelang es sogar einigen Insassen auf dem Boden des Schlosses mit dem Bau eines Segelflugzeugs zu beginnen. Ein ebenso kühner wie verrückter Plan, der aber nicht zum Abschluss kam, denn ehe sich das Maschinchen in die Lüfte heben konnte, befreiten die Amerikaner das Lager »Oflag IV c« .
Bis heute kommen die Kinder und Enkel aus den Niederlanden und Großbritannien, um »The Colditz Story« im »Fluchtmuseum« zu besichtigen. Und es gibt keinen Film, keine Fernsehserie fragt Robert? Das muss man schleunigst nachholen, sagt er und by, by, ehe wir die englischsprachige Gegend verlassen, Sachsen hat uns wieder.
Flussabwärts öffnet sich die Auenlandschaft, wo bei Sermuth die Zwickauer Mulde, der wir bisher gefolgt sind, mit der Freiberger Mulde zusammenkommt. Nun verlässt das gemeinschaftliche Gewässer bei Höfgen das Sächsische Burgenland. Auf dem linken Muldenufer bei Nimbschen erstreckt sich ein weites Waldstück, das Klosterholz; hier liegen die Ruinen des Zisterzienserklosters Nimb- schen. Robert buchstabiert die Gedenktafel, die an die Nonne Katharina von Bora erinnert, die in der Osternacht 1523 mit anderen Schwestern aus dem Kloster floh. Zwei Jahre später heiratete sie Martin Luther. Und ehe Robert seine Frage anbringen kann, sagen wir: Ja, das Abenteuer gibt es schon im Film.
Ach ja, ehe wir die Muldenaue verlassen, gilt es Meister Wilhelm Ostwald einen Besuch abzustatten, der nahe dem Fluss sein Haus »Energie« in Großbothen errichtete. Ostwald ist heute eine beinahe vergessene Gestalt der deutschen Wissenschaftsgeschichte, obwohl er 1909 als einer der ersten Deutschen den Nobelpreis für Chemie erhielt. Aber Ostwald war nicht nur ein bedeutender Gelehrter, sondern auch ein begnadeter Kauz. Er ließ sich keine Gelegenheit entgehen, mit seinen Einmischungen Dutzende von philosophischen und politischen Kämpfen zu bewegen bis hin zu seiner Philosophie der Energetik: »Vergeude keine Energie, verwerte sie.« Nachdenklich meint Robert: Das ist ein Stück Amerika.
Die nächste Station ist Grimma, wo wir die Flusslandschaft verlassen werden. Hier zieht die Mulde breit und träge dahin. Die Stadt war in den vergangenen Jahren immer wieder vom Hochwasser überflutet. Nun wird ein neues Deichsystem die Wasser abhalten. Wir aber spazieren in die Stadt hinein, mit der Erfahrung von Johann Gottfried Seume, dem deutschen Aufklärer, der hier seinen berühmten »Spaziergang nach Syrakus« begann: »Wer geht, sieht im Durchschnitt anthropologisch und kosmisch mehr, als wer fährt ... Man kann fast überall bloß deßwegen nicht auf den Beinen bleiben, weil man zuviel fährt ...«
Ach, sagt Robert, der Mann kannte seine Pappenheimer, und damit sind seine Amerikaner ebenso gemeint wie die Sachsen. Ob er das im sächsischen Dialekt schrieb oder im flotten Latein, dem Englisch seiner Zeit? Wir wissen es nicht. Wir sitzen im nachmittäglichen Sonnenlicht an der Mulde und sagen: Mit einem Amerikaner in fünf Stunden von Amerika nach Grimma, keine schlechte Reise.

Wir behalten den Überblick!
Mit unserem Digital-Aktionsabo kannst Du alle Ausgaben von »nd« digital (nd.App oder nd.Epaper) für wenig Geld zu Hause oder unterwegs lesen.
Jetzt abonnieren!
Linken, unabhängigen Journalismus stärken!
Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.
Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.