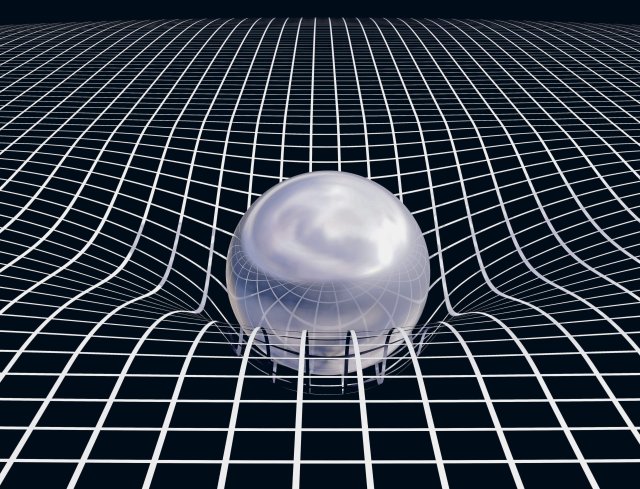Aus Fehlern lernen ist schwer
Studie zeigt: Bei Schülern niedriger Klassenstufen wirkt Kritik häufig kontraproduktiv
»Das hast du aber gut gemacht!« Ein solches Lob motiviert vermutlich jedes Kind, sich beim Lernen weiterhin anzustrengen. Wie aber steht es mit Kritik? Im Alter von etwa acht Jahren, so lehrt die Erfahrung, sind Kinder damit in der Regel überfordert. Auf Urteile wie: »Das war falsch!« oder: »So geht das aber nicht!« reagieren sie daher mit Unverständnis. Auch streben sie nicht danach, ihre Fehler zu korrigieren. Im Gegenteil: Getadelte Kinder machen gewöhnlich noch mehr Fehler.
Um herauszufinden, warum das so ist, haben niederländische Hirnforscher jetzt ein Experiment durchgeführt. Die Wissenschaftler um Eveline Crone von der Universität Leiden nutzten dabei die Möglichkeiten der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT). Dieses bildgebende Verfahren beruht auf einem einfachen Grundprinzip: Wenn bestimmte Regionen im Gehirn aktiv sind, benötigen sie mehr Sauerstoff und werden folglich stärker durchblutet. Der Magnetresonanztomograph macht diese Veränderungen sichtbar und zeigt somit an, wie unser Gehirn in Echtzeit »arbeitet«.
Um das kindliche Lernverhalten genauer studieren zu können, teilten die Forscher ihre Versuchspersonen in drei Gruppen ein. In der ersten Gruppe waren die Kinder acht bis neun, in der zweiten zwölf bis dreizehn Jahre alt. Die dritte Gruppe bestand aus jungen Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Im Experiment mussten alle Probanden am Computer verschiedene Denkaufgaben lösen. Lagen sie dabei richtig, erschien auf dem Bildschirm ein Häkchen. Ein Fehler wurde dagegen mit einem Kreuz quittiert.
Was derweil im Kopf der Versuchsteilnehmer vorging, konnten die Forscher an Hand eines Computertomographen verfolgen. Ergebnis: Bei den Acht- bis Neunjährigen reagierten einige Hirnregionen, die für die Kontrolle der geistigen Tätigkeit zuständig sind, stark auf eine positive, aber kaum auf eine negative Bewertung. Bei den älteren Kindern sowie den Erwachsenen war es genau umgekehrt. Hier wurden die Kontrollregionen im Gehirn am stärksten aktiviert, wenn die betreffenden Personen einen Fehler gemacht hatten.
Wie Crone und ihre Kollegen im »Journal of Neuroscience« (Bd. 28, S. 9495) mitteilen, seien sie über dieses Resultat zunächst überrascht gewesen: »Eigentlich hatten wir erwartet, dass die Gehirne der Achtjährigen auf die gleiche Art arbeiten wie die der Zwölfjährigen, nur nicht so effizient.« Bei näherer Betrachtung erscheint das Ergebnis jedoch plausibel. Denn kleine Kinder können leichter begreifen, dass sie etwas richtig gemacht haben. Mit Fehlern umzugehen, ist hingegen viel schwerer. Es bedeutet nämlich, dass man die gefundene Lösung aufgeben und sich etwas Neues einfallen lassen muss. Eine solche Lernstrategie beherrschen Kinder offenkundig erst im Alter von etwa 12 Jahren.
Bisher kann niemand sagen, ob die kognitiven Unterschiede zwischen jüngeren und älteren Kindern durch die Reifung des Gehirns oder durch Lernerfahrungen zustande kommen. »Vermutlich ist es eine Kombination aus beiden Faktoren«, meint Eveline Crone, die mit ihren Kollegen hier weiterforschen will. Ungeachtet dessen bestätigen die Ergebnisse der Studie erneut eines der wichtigsten Prinzipien der Pädagogik: Lernen ist kein Prozess, der in allen Altersstufen auf den gleichen Voraussetzungen beruht. Es gibt vielmehr sogenannte sensible Phasen, gewisse Zeitfenster also, in denen Kinder besonders empfänglich sind für den Erwerb spezieller Fähigkeiten und Kompetenzen. Um ein einfaches Beispiel zu nennen: Ein 15-Jähriger hat in der Regel erhebliche Schwierigkeiten, sich die grammatische Struktur einer Sprache neu anzueignen. Einem Fünfjährigen gelingt dies hingegen mühelos. Denn in sensiblen Phasen neigen Kinder zu einer selektiven Wahrnehmung. Das heißt, sämtliche Dinge, die für sie während dieser Zeit wichtig sind, werden ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Alles andere verliert im Vergleich dazu an Bedeutung.
Ausgehend von solchen Beobachtungen hat der Schweizer Psychologe Jean Piaget (1896-1980) eine Theorie der kognitiven Entwicklung begründet, die verdeutlicht, dass sich die Fähigkeit eines Kindes, geistige Operationen durchzuführen, von einer sensiblen Phase zur nächsten nachhaltig verändert. Zwar wurde diese Theorie später in einigen Details revidiert. Piagets Grundkonzept jedoch hat sich in zahlreichen Untersuchungen bewährt. Auch die neue Studie aus den Niederlanden zeigt: Ohne bestimmte hirnphysiologische Voraussetzungen und geistige Erfahrungen kann ein Kind selbst bei bester pädagogischer Betreuung keine Kompetenzen erwerben, die seinem Alter nicht gemäß sind. Im vorliegenden Fall wäre das der Umgang mit eigenen Fehlern.
Die Kenntnis all dessen mag durchaus bildend sein. Doch Studien wie die vorliegende bleiben pädagogisch wirkungslos, wenn sie nicht auch Eingang in die schulische Praxis finden. Etwa bei der Beantwortung der Frage: In welcher Klassenstufe ist es sinnvoll, die Leistungen der Schüler mit Noten zu bewerten? Nimmt man nämlich die Ergebnisse der neuen Studie ernst, dann können Achtjährige mit Kritik nicht produktiv umgehen. Es steht deshalb zu befürchten, dass das herabsetzende Urteil, das sich normalerweise hinter schlechten Zensuren verbirgt, auf die betreffenden Schüler entmutigend wirkt. Geht man andererseits zu verschwenderisch mit Lob und Anerkennung um, sind Kinder leicht geneigt, sich vom Unterricht zurückzuziehen, weil sie glauben, schon alles zu können. Pädagogik ist so betrachtet die hohe Kunst, didaktische Extreme zu vermeiden und stattdessen zu prüfen, von welchen schulischen Maßnahmen Kinder in einem bestimmten Alter am meisten profitieren. Damit ließe sich zuletzt auch klären, ob die Theorie von den sensiblen Phasen schon ausgereift genug ist, um die Widersprüchlichkeit der kindlichen Entwicklung adäquat zu beschreiben.
Noten? Mangelhaft!
Schulnoten lassen keinen wirklichen Vergleich des Wissens- und Leistungsstandes von Schülern zu. Zu diesem Ergebnis kam bereits 2006 eine wissenschaftliche Studie der Universität Siegen, die im Auftrag des deutschen Grundschulverbandes entstand. »Durch den Vergleich mit anderen entmutigen Noten schwächere Schüler, statt ihre Fortschritte zu honorieren und sie zu weiteren Anstrengungen anzuspornen. Vor allem aber erlauben sie keine zuverlässigen Vorhersagen, wie einzelne Kinder sich entwickeln werden«, betont der wissenschaftliche Leiter der Untersuchung, Hans Brügelmann.
Besondere Probleme sieht Brügelmann in der Kopplung von Noten und Auswahl. »Die Noten dienen in Deutschland nur der Verteilung und Aussonderung von Schülern«, heißt es in der Studie. Bildungsforscher plädieren daher seit Längerem für differenzierte Wortgutachten unter Beteiligung der Schüler, in denen Lernziele, -methoden und -fortschritte festgehalten werden. jam

Wir behalten den Überblick!
Mit unserem Digital-Aktionsabo kannst Du alle Ausgaben von »nd« digital (nd.App oder nd.Epaper) für wenig Geld zu Hause oder unterwegs lesen.
Jetzt abonnieren!
Linken, unabhängigen Journalismus stärken!
Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.
Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.