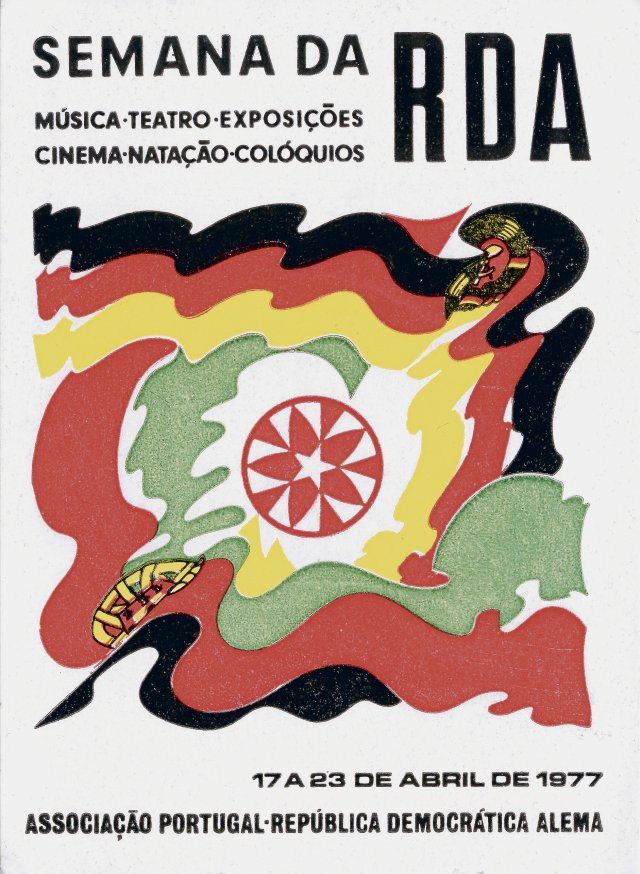Das ist doch alles gar nicht so gemeint
MEDIENgedanken: 60 Jahre »Bild«-Zeitung - Einsichten aus dem Innenleben einer Boulevardzeitung
Ich war Zwanzig, als ich 1978 in der Münchner Lokalredaktion der »Bild«-Zeitung mein erstes Zeitungspraktikum absolvierte, was zu meiner Ausbildung an der Münchner Journalistenschule gehörte, die ich damals besuchte. Diese Zeit hatte eine ungeheure Auswirkung auf mich. Tatsächlich glaube ich bis heute, dass ich dort mehr für meinen Beruf gelernt habe als in der gesamten Zeit an der Journalistenschule. Gleichzeitig hatte diese Hospitanz, obwohl ich sie erfolgreich hinter mich brachte, eine solch abschreckende Auswirkung auf mich, dass ich eigentlich keine Journalistin mehr sein wollte.
Es war ein Zufall, der mich in die Redaktionsräume der »Bild« München brachte. Ein dreimonatiges Zeitungspraktikum gehörte wie gesagt zu unserer Ausbildung, und die Plätze in München wurden verlost, so geriet ich an »Bild«. Das war das Letzte, was ich mir gewünscht hatte. Günther Wallraffs Buch »Der Aufmacher«, in dem er die Praktiken der »Bild«-Zeitung anprangerte, war Pflichtlektüre für jeden Journalistenschüler. Freilich: die »Bild«-München-Redaktion schien eine der harmloseren zu sein, sie wird in den gesamten Wallraff-Recherchen nur einmal erwähnt. Aber »Bild« verkörperte für uns Journalistenschüler die Inkarnation des Schmuddeljournalismus', und der politischen Infamie. Journalisten aus allen Münchner Zeitungsredaktionen unterrichteten uns, nicht aber von Springers »Bild«.
So graute mir vor dem, was mich erwartete, doch gleichzeitig war ich auch angenehm aufgeregt. Würde ich in die Abgründe des Boulevardjournalismus schauen? Doch das »Prinzip ›Bild‹« funktionierte viel subtiler als Wallraff es beschrieben und ich es geglaubt hatte. Bei der »Bild«-Zeitung wurde sehr genau recherchiert, viel genauer als in den meisten anderen Redaktionen, die ich später kennengelernt habe. Von Anfang an die Tatsachen zu verdrehen oder zu erfinden, das war nicht erlaubt. Im Gegenteil, es galt so viele Tatsachen wie möglich zu erforschen, und zwar bis ins kleinste Detail. Eine Agenturmeldung einfach zu übernehmen, das war nicht erlaubt. Eine Agenturmeldung gab mir den Anhaltspunkt, wen ich anrufen konnte, um mehr zu erfahren, welche Autobahnmeisterei mir z. B. Auskunft erteilen konnte, wenn ich einen Unfallhergang rekonstruieren wollte. Die Meldung lautete: ein Fuchs hatte einen spektakulären Auffahrunfall verursacht, mit einem Ferrari als Hauptbeteiligten. Die Nachfrage galt allem: War es wirklich ein Fuchs, war es wirklich ein Ferrari, welche Farbe hatte er, wie viele Personen saßen in ihm und wie alt war der Fahrer? Oh, diese Frage nach dem Alter! Wie oft musste ich in meinen ersten Tagen noch einmal und noch einmal anrufen, um solche Details zu klären. Und siehe da, wenn alle Fakten auf dem Tisch lagen, stellte sich oft heraus, dass die Kollegen von der Agentur einige Fehler gemacht hatten: der Ferrari war ein Porsche, grün und nicht blau, und der Fuchs ein Hase. Doch dann stellte sich die Frage, ob wir aus einem an sich harmlosen Auffahrunfall eine Massenkarambolage machen konnten. Und wenn das nicht möglich war, wurde die Geschichte fallen gelassen. Das geschah mit zwei von drei anrecherchierten Storys.
Ein anderes Beispiel: Ich wurde zu einem kleinen Familienzirkus geschickt, der in München Winterquartier machte. Wir hattn gehört, er habe noch kein Quartier, er sei in München gestrandet. Als ich dorthin kam, stellte sich die Lage weit weniger dramatisch dar. Es war ein sehr kleines Zirkusunternehmen, das sich nur mühsam über Wasser hielt. Ein paar von den Zirkusleuten bettelten in der Innenstadt mit einem ihrer Tiere. Nichts besonderes also. So berichtete ich dem zuständigen Redakteur. Es war eine dieser Geschichten, die man hätte fallen lassen können. Aber so ein armer Zirkus lässt Bilder in uns entstehen, die zu Herzen gehen.
Ich habe den Namen des Redakteurs vergessen, aber ich sehe ihn noch vor mir, wie er da saß - die Füße auf den Schreibtisch gelegt - und vor sich hin sang: »Oh mein Papa«. Schließlich kam er auf die Idee, ob wir die Geschichte nicht mit einem Foto von einem kleinen Mädchen auf dem Seil schmücken könnten. Ich fuhr mit einem Fotografen zum zweiten Mal zum Zirkus, und der Besitzer willigte nach einigem Zögern ein, seine kleine siebenjährige Tochter auf ein etwa anderthalb Meter hohes Seil zu schicken. Er tat es ungern, weil er Angst um sie hatte, es gab keine Seilakrobatik in diesem Zirkus, aber wie die meisten Zirkusleute hatten sie Grundkenntnisse von fast allen üblichen Nummern. Der Fotograf lag auf dem Fußboden um das Seil im Bild höher erscheinen zu lassen, und wir druckten eine herzergreifende Geschichte von einem notleidenden Zirkus, die mit den Worten »Oh mein Papa« begann.
Das war das »Prinzip ›Bild‹«: Alle Tatsachen zu sammeln, um dann eine Sache herauszupicken und neunzig wenn nicht 99 Prozent der übrigen Tatsachen einfach weg zu lassen. Ich bin sicher, ich hätte von diesen Zirkusleuten so viele Interessantes erfahren können, warum und wie sie ihr Leben führten. Ich habe einige Jahre später eine zweistündige Radioreportage über einen norddeutschen Familienzirkus gemacht. Es war so spannend, so als ob man in eine Parallelwelt eintauchen würde, die nicht Tausende von Kilometern entfernt, sondern gleich um die Ecke stattfand. Aber davon fand sich in meiner »Bild«-Reportage nichts. Es hätte nicht dem Klischee entsprochen. Wir hätten das Paradies auf Erden finden können und es am Ende doch nur als Ballermann beschrieben.
Erleichtert wurde diese Art von Journalismus durch die Trennung von Rechercheuren und Schreibenden. Als Anfängerin wurde ich auf einen Termin geschickt, kam mit den Fakten zurück in die Redaktion und versuchte mich an einer Geschichte - die dann bis zur Unkenntlichkeit umgeschrieben und verändert wurde. Das erging aber nicht nur mir so. Tatsächlich schaffte ich es nach einem Monat meines Praktikums, immer öfter unverändert ins Blatt zu kommen. Ich hatte begriffen, worum es geht. Ich hatte das »Prinzip ›Bild‹« verinnerlicht. Unbewusst. Und verlor gleichzeitig meine Lust auf den Journalismus. Auch das wurde mir erst sehr viel später bewusst.
Ich unterstelle heute, dass es nicht nur mir so ging, sondern dass es der Preis war, den alle dort zahlten, weil sie für »Bild« arbeiteten. Ich habe selten eine Ansammlung so unzufriedener und - ja, hysterischer - Menschen getroffen, wie in der Redaktion von »Bild«. Alle hatten irgendeinen Spleen, alle hatten irgendein teures Hobby. Ein Fotograf z. B. sammelte Schnapsgläser. Unterwegs zu einem Termin zeigte er mir in einer Auslage ein Stamperl: »Das hätte ich gern.« Sechzig Mark kostete es, das war damals viel Geld für etwas, das für mich wie billiges Pressglas aussah. Eine Redakteurin sammelte Tiffany, die andere rauchte die teuerste Zigarettenmarke, die damals auf dem Markt war, so versicherte sie mir. Sie verdienten bei »Bild« alle überdurchschnittlich gut. Aber ich fand bald heraus, dass fast alle Geldsorgen hatten. Ihre Ansprüche, ob für Klamotten, Reisen, Ausgehen und eben ihre Hobbys waren einfach zu groß. Gegen vier oder fünf Uhr nachmittags, wenn die Geschichten geschrieben waren, wurden die Schubladen geöffnet und die Gläser herausgeholt. Dann begann das Trinken, der Klatsch, das Anbaggern. Die Atmosphäre wurde schwül. Mag sein, dass das auch in anderen Redaktionen so war, aber ich habe es nie wieder so extrem erlebt.
Warum das so war? Niemand dort war wirklich stolz auf seine Arbeit, auf die Geschichten, die er veröffentlichte. Dabei erlebte ich bei meinen Recherchen oft eine merkwürdige Kumpanei der Leute, die ich interviewte, mit mir. Mit gesenkter Stimme vertrauten sie mir an, wie sehr sie unser Blatt schätzten, wie interessant es doch sei. Akademiker waren darunter, die das laut und öffentlich nie zugegeben hätten. Am liebsten hätte ich gesagt: Ihr könnt das doch nicht ernst nehmen, was wir da schreiben, das ist doch alles gar nicht so gemeint. Gleichzeitig musste ich mich damals und auch später ständig verteidigen, dass ich für »Bild« arbeitete. Meine späteren Kollegen beim Süddeutschen Rundfunk rümpften über »Bild« die Nase. Auch das oft zu Unrecht, wie ich fand. Denn das Mikrofon für zwei Minuten zu öffnen und dann vierzig Sekunden zu senden ohne nachzufragen, ist auch keine große Kunst. Und das geschah nur allzu oft.
Dennoch: als mein Praktikum nach drei Monaten beendet war, bot mir der Chefredakteur an, als Freie weiter zu arbeiten. Meine Ausbildung hätte das erlaubt, aber ich lehnte ab, ohne nachzudenken. Ich hätte nicht sagen können warum, aber es war die richtige Entscheidung.
Die Autorin ist freie Journalistin und lebt in Berlin.

Wir behalten den Überblick!
Mit unserem Digital-Aktionsabo kannst Du alle Ausgaben von »nd« digital (nd.App oder nd.Epaper) für wenig Geld zu Hause oder unterwegs lesen.
Jetzt abonnieren!
Linken, unabhängigen Journalismus stärken!
Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.
Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.