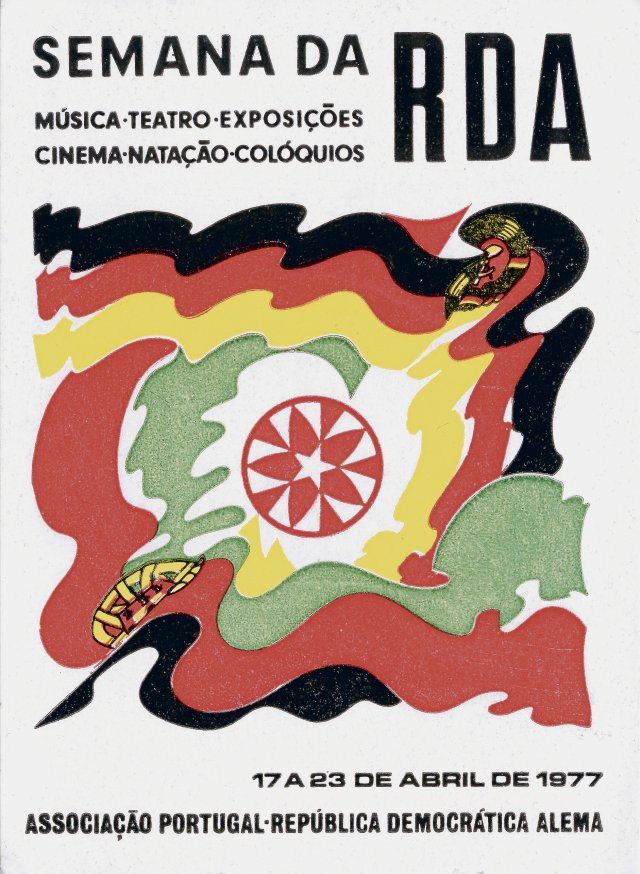Rückblick
Rainer Lehmann hat mit »Momente deutscher Unschuld« eine historisch wertvolle Dokumentation geschaffen. Von Christina Matte (Text) und Joachim Fieguth (Bild)
Im Jahr 1989 befand sich Rainer Lehmann an der Erdgastrasse in Perm, mehr als 4000 Kilometer von der Heimat entfernt. Sehr weit weg also. Seine Heimat, das war die DDR. Ein Land, dessen Bevölkerung aufbegehrte. Als Rainer Lehmann in seine Heimat zurückkehrte, sollte das Land nur noch wenige Monate bestehen. Um zu begreifen, was vor sich gegangen war, sammelte und las er in den folgenden Jahren all die Leserbriefe, die vom August 1989 bis September 1990 in den Zeitungen* der ehemaligen drei Nordbezirke der DDR - Rostock, Neubrandenburg, Schwerin - veröffentlicht worden waren. Mehr als 1800 Wortmeldungen waren zum Abdruck gekommen - von Arbeitern, Bauern, Direktoren, Bürgerrechtlern, Parteifunktionären, Genossen von der Basis, Kulturschaffenden, Leistungssportlern, Lehrern. Rückblickend kam Lehmann zu dem Schluss: »Nie waren so konträre Positionen aufeinander gestoßen, und nie war der Meinungsaustausch so wichtig und so geachtet.«
Zu etlichen der Leserbriefschreiber hat Rainer Lehmann in den Jahren von 2008 bis 2014 Kontakt aufgenommen und sie um ihre heutige Sicht auf die Ereignisse von damals und auf den Fortgang der Geschichte gebeten. Etwa 400 haben ihm geantwortet. Jetzt sind die früheren und die aktuellen Briefe unter dem Titel »Momente deutscher Unschuld« erschienen. Entstanden ist eine umfangreiche, historisch wertvolle Dokumentation des Umbruchs.
Doch war es tatsächlich so, wie Rainer Lehmann in seinem Vorwort schreibt, dass »die Ostdeutschen« anfangs zunächst Reformen wollten und ein anderes gesellschaftliches Modell anstrebten? Oder wollte dies nur ein Teil derjenigen, die zuerst protestiert hatten, und dann auch jene Mitglieder der SED und der Blockparteien, die sich über die nun thematisierten Missstände in Politik und Wirtschaft empörten? War in jener Aufbruchszeit der Fall der DDR überhaupt schon denkbar? Wurde der Ruf »Wir sind ein Volk« nicht erst mit der zunehmenden Destabilisierung der Verhältnisse möglich? Und waren, die das riefen, dieselben, die zuvor den Diskurs in den Medien geführt hatten? Wir besuchten zwei der Protagonisten, die damals zum Stift griffen.
*
Der Tierarzt Dr. Waldemar Siering lebt in Neubrandenburg, im Ortsteil Lindenberg-Süd. Die Straßen dort heißen Robinien-, Platanen-, Ebereschen-, Rotdornstraße oder Magnolien-, Akelei- und Weißdornweg - schön. Gesäumt werden sie von nach 1990 erbauten klinkerroten Ein- und Mehrfamilienhäusern, einige sind Eigentum, andere werden zur Miete oder zur Sozialmiete bewohnt. »Auf diese Mischung haben wir geachtet«, sagt Dr. Siering, »das ist kein elitäres Viertel.« Wir, damit meint er die Neubrandenburger Stadtvertretung, der er für die SPD als Ratsherr von 1990 bis 1998 angehörte.
Am 1. August 1990 hatte er dem »Mecklenburger Aufbruch«, der ersten unabhängigen Wochenzeitung der DDR, unter anderem geschrieben: »Politisch bin ich schon lange aktiv, aber in einer Partei erst seit Oktober 1989 …«
Es war der 8. Oktober 1989, als Waldemar Siering gemeinsam mit seinem damaligen Nachbarn Arno Behrend, der tags zuvor zur Gründung der SDP nach Schwante bei Berlin gefahren war, beschloss, in Neubrandenburg eine SDP-Ortsgruppe zu gründen. Die Bürgerbewegung genoss seinen Respekt, aber, so Siering, »wenn man Erfolg haben will, muss man langfristig denken und handeln - mit Frauen und Männern, die zusammenstehen«. Beim »Neuen Forum« sah er das nicht als gegeben, »die Ost-SPD hatte einen viel längeren organisatorischen Vorlauf, auch wenn sie erst später in die Öffentlichkeit trat«. Was wollte Siering damals erreichen? »Wir stellten die Vereinigung von KPD und SPD 1946 zur SED in Frage«, sagt er. »Wir stellten die Machtfrage, und damit wollten wir das System sprengen.«
Dass die Einheit so schnell kommen würde, damit hatten freilich auch die Ost-Sozialdemokraten nicht gerechnet. »Auch weil die West-SPD uns anfangs nicht wollte«, erinnert sich Waldemar Siering. »Egon Bahr und Walter Momper setzten auch weiterhin auf Gespräche mit der SED und auf Reformen.« Für ihn selbst und seine Mitstreiter seien das Staatswesen DDR und die Wirtschaft aber nicht reformierbar gewesen. Kurz: »Das Vertrauen war weg, und wir dachten an die Zukunft unserer Kinder.«
Das Verhältnis zur West-SPD habe sich erst dann gebessert, als Hans-Jochen Vogel sich für die Genossen im Osten einsetzte. Er sei auch nach Neubrandenburg gekommen. Siering, der auch LPG-Großtieranlagen betreut hatte und als »Wanderprediger in Sachen Rindergesundheit« bekannt war, erinnert sich: »Wir beide fanden rasch einen persönlich-fachlichen Draht. Sein Großvater hatte seinerzeit in Bayern die künstliche Besamung bei Rindern einführen geholfen, und so kamen wir über die Landwirtschaft gut in weitere Themen.«
21 Jahre nach seinem Leserbrief an den »Mecklenburger Aufbruch« berichtete Waldemar Siering Rainer Lehmann auf Anfrage am 25. März 2011 unter anderem dies: »Wir hatten, wen wundert es, wenig Erfahrung in der angewandten Politik, hier der Kommunalpolitik, aber den Willen zur Veränderung und auch ein Programm für eine Stadt mit Bürgern, die zur Beteiligung an ihren Angelegenheiten, deren Gestaltung aufgerufen und mündig sind ...« Dass sie damals beim Aufbau einer neuen Verwaltung »Sippenhaft« ausgeschlossen haben, finde er immer noch richtig. Gelungen seien der Ausbau von Angeboten in Kultur, Bildung und Sport. Sorge bereite ihm dagegen, dass sich Bürger aus der Gestaltung ihrer Angelegenheiten zurückziehen, ebenso die Abwanderung vor allem junger Menschen: »30 000 Menschen haben wir verloren, weil große Betriebe eingingen und zu wenig neue Arbeitsplätze geschaffen wurden.« Während unseres Gespräch resümiert er: »Manches hätte besser laufen können, doch wir haben es ganz gut hingekriegt.«
Als Dr. Waldemar Siering uns verabschiedet, weist er auf seine Nachbarschaft: »Hier weht die Fahne der SPD.« Auch Parteifreunde haben einst in Lindenberg-Süd gebaut. Ist er noch zufrieden mit seiner Partei? Sie dürfe, vor allem mit Blick auf Russland, nicht nur kurzfristig denken und handeln. »In Lugansk steht ein Wegweiser: 650 Kilometer bis Stalingrad. Dort hat Deutschland im Zweiten Weltkrieg, den es angezettelt hat, die größte Niederlage erlitten. Das dürfen wir nie vergessen.«
*
In Ahlbeck treffen wir den 73-jährigen Horst Miegel. Seit über 50 Jahren lebt der gebürtige Sassnitzer auf Usedom. Am 22. November 1989 hatte die »Ostseezeitung« seine Replik auf die Meinungsäußerung einer offenbar äußerst betroffenen SED-Genossin veröffentlicht, die sich auf die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung berief und geschrieben hatte: »Die Partei ist mehr als eine Institution.« Miegel hatte ihr entgegengehalten: »Diese Worte lassen mich sehr tief nachdenken, obwohl ich keiner Partei zugehörig bin. Diese Worte würden auf einer Demo Pfeifkonzerte auslösen, doch wäre ich ein Kommunist, würde ich mich für diese Worte steinigen lassen.«
Miegel war kein Kommunist. Nach der Klempner- und Installateurslehre hatte er auf der Fähre Sassnitz-Trelleborg angeheuert und dann wegen einer despektierlichen Bemerkung über den damaligen Partei- und Staatschef Walter Ulbricht ein Jahr im Knast absitzen müssen. Ein Kommunistenhasser ist er deshalb nicht geworden. Am 28. Mai 2009 schrieb er an Rainer Lehmann unter anderem: »Ich erinnere mich noch sehr gut an diese Tage im Herbst 1989, es waren die aufregendsten, aber auch die glücklichsten Tage. Ich kann wohl behaupten, dass wir für kurze Zeit das glücklichste Volk der Erde waren.« Und weiter: »So lange der Ruf erscholl: ›Wir sind das Volk‹, war ich ganz bei der Sache, es gab die Hoffnung auf eine bessere, demokratische DDR. Der Ruf ›Wir sind ein Volk‹ bewirkte eine innerliche Kehrtwende ...« Miegels Brief endet: »Wenn mein Bericht auch von Resignation getragen ist, so möchte ich doch sagen, dass ich zwar nicht glücklich bin, aber doch zufrieden, was das System betrifft.«
Nicht glücklich? In einem Haus in Ahlbeck, nur wenige Minuten von der Strandpromenade entfernt? Horst Miegel erzählt, dass er nach seiner Haftentlassung noch den Beruf des Heizungsmonteurs erlernt und die Meisterprüfung abgelegt hat, mit der Note »Sehr gut«. Als es zur Einheit kam, musste sein Betrieb dicht machen, und er wurde vorübergehend arbeitslos. Von Demütigungen berichtet er, von der Arroganz der Altbesitzer und der neuen Arbeitgeber, von Sprüchen wie »Ihr müsst noch viel lernen« oder »Du bist nicht zum Denken, sondern zum Arbeiten hier.« Materiell gehe es ihm gut, was auch durch die für Investoren attraktive Lage seines Wohnortes begünstigt worden sei. Die drei Töchter und fünf Enkel könnten ebenfalls nicht klagen. Und dennoch. »Sehen Sie«, sagt Horst Miegel, »ich habe keinen Grund zu meckern. Aber wie kann ich glücklich sein, wenn meine Nachbarn unglücklich sind?«
Wir nehmen uns Zeit und spazieren zusammen zur Seebrücke, auf der er in diesem Jahr noch nicht war. Zu viele Urlauber und Touristen. Miegel fingert eine Schachtel aus der Jackentasche und beginnt zu rauchen - F6. Früher sei er den Westzigaretten hinterhergerannt, heute nicht mehr. »Ich mache nicht, was alle machen. Ich habe meinen eigenen Kopf«, sagt er. Er hat Redebedarf. Über Gorbatschow, Russland, die Ukraine, über Flüchtlinge an den Grenzen Europas, über die Welt, die in keinem guten Zustand ist. »Meine Nachbarn sind unglücklich«, sagt Horst Miegel.
Zu seinen »unglücklichen Nachbarn« gehört auch die Natur. Seit er sich eine Nikon D800E geleistet hat und damit fotografiert, hat er einen »anderen Blick« entwickelt - er freut sich über jeden Wurm, den er früher zertreten hätte, über jedes gelbe Blatt, über das er sich früher geärgert hätte, weil im Garten schon wieder so viel Laub liegt. Auch Miegels Blick auf seine neuen Mitbürger ist schärfer geworden. »Viele, die hergezogen sind oder in den Luxushotels absteigen, regen sich auf über das Geschrei der Möwen. Die sollten in die Berge fahren, aber da sind ja die Kühe mit ihren Glöckchen. Man muss sich wohlfühlen, wo man lebt.« Horst Miegel sagt, er fühle sich wohl. »Mein Zuhause ist die Insel. Das andere ignoriere ich.« Er kann sich das leisten, weil er sich jetzt frei fühlt. »Nicht wegen Helmut Kohl«, erklärt er, »sondern wegen meines Alters. Ich bin froh, im Finale zu sein.«
*Es handelte sich um die »Ostseezeitung« (SED), die »Schweriner Volkszeitung« (SED), die »Freie Erde« (SED), die »Norddeutschen Neuesten Nachrichten« (NDPD), die »Norddeutsche Zeitung« (LDPD), den »Mecklenburger Aufbruch«, »Der Demokrat« (CDU), und die »Kirchenzeitung«. Wer sich für Rainer Lehmanns Trilogie interessiert, wendet sich an lemarin@live.de

Mehr Infos auf www.dasnd.de/genossenschaft
Linken, unabhängigen Journalismus stärken!
Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.
Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.