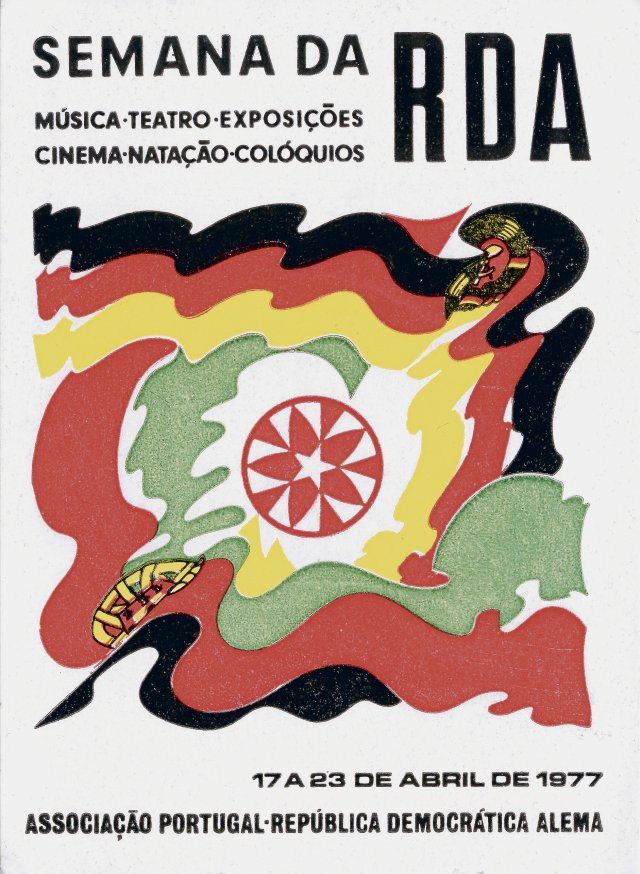Gruß aus der Zukunft
Gedanken zum Totensonntag
Totensonntags schweigen wir. Und keiner wünscht einen Mauerfall herbei: Ja, Friedhofs Steinwall - halt stand gegen die Wellen Lärm von draußen! Hier drinnen, bei den Gräbern, umwuchert Natur alte Grabsteine, es ist, als fände ein Verschmelzen des Leblosen mit dem Lebendigen statt und man wachse nun gemeinsam und webe vereint am Geheimnis des Ortes.
Die Toten selber haben kein Geheimnis. Sie sind die überwältigende Mehrheit - im Besitz der nacktesten, unverrückbarsten Wahrheit: gestorben zu sein. Wir gedenken ihrer, wir erinnern an sie, wir ersehnen, dass sie wieder redeten. Aber wenn wir nur ehrlich zu uns selbst wären, müssten wir gestehen: Sie sprechen sehr wohl mit uns. Und wenn wir noch ehrlicher zu uns selbst wären, müssten wir zugeben, dass wir nicht wirklich hören wollen, was sie uns sagen. Sie sagen nicht viel - aber alles: Sie grüßen uns aus unserer Zukunft. Sie warten auf uns, »auf der Gegenschräge«, wie Heiner Müller schreibt. Etwas ist zu schön, um wahr zu sein, sagt man leichthin. Wen das Gestorbensein an der Seele packt, der wird fortan auf Lebensstunden stoßen, die sind, wenn sie wirklich schön sind, zu schön, um nicht an den Tod zu denken. Im Moment, da es dir entgleitet, glänzt doch am innigsten, was du festhalten möchtest.
»Mag sein, ich liebe das Leben mehr als alle«, so Heinrich von Kleist, aber ebenso wird er notieren, dass ihm »auf Erden nicht zu helfen« sei. Und wird zur Pistole greifen. Die Liebe zum Leben, ein Leben zur Liebe hin - wie viele Beben sind auf diesem Wege möglich, wie viel an Bruch und Brennen und Bersten. Bis das Leben, das nicht mehr kann, auch nicht mehr will. Nichts mehr will, in dieser Welt, von dieser Welt. Und plötzlich enthüllt all seine Härte, was oft so befreiend klingt: Ein Mensch macht sich auf - und davon.
Die langjährige »Stern«-Reporterin Birgit Lahann hat ein Buch geschrieben über achtzehn Dichter und Maler, die den Freitod wählten: »Am Todespunkt«. Von Karoline von Günderode (1806) bis zur österreichischen Schriftstellerin Brigitte Schwaiger (2010). Jessenin und Toller, Tucholsky und Inge Müller, van Gogh und Primo Levi. Suche nach Gründen, Recherche im Grauen, Steigen in Grüfte, Sammeln von Spuren, die keinem Gesetz mehr folgen. Gesetz! Es gibt kein Gesetz, keine Satzung mehr, wenn Fügung und Chaos andere Pläne mit dir haben, und es gibt keine bürgerliche Gegend mehr, wenn der Trieb, die Angst, die Obsession, der Wund- und Grundschmerz dich über alle Grenzen treibt, wenn die Sehnsucht nach Souveränität als Einladung zum Sterben nach dir greift. Wenn also dieser eiskalte Doktor Faust in dir und dieser Herrenmensch Raskolnikow in dir und Joseph Conrads Marlowe in dir und der gedemütigte Jesus in dir, wenn sie alle jenes Herz der Finsternis in dir - das kein Kardiologe attestieren kann - mit Stoff versorgen. Ein Stoff, der die Selbsterhebung und die Selbstauflösung zusammenführt. Den Mut und das Matte. Freitod ist Freiheit. Ist Mord ohne Sühne. Sage keiner, das sei fürs eigene Leben undenkbar. Traue keiner seinem Herzschlag der Biederkeit, seinen Temperaturen des Ebenmaßes, seinem Einverständnis mit der Knechtschaft des Alltags. In jedem Menschen lauert ein Infarkt auf seine Stunde.
Aus diesem Buch spricht das Furchtbare, das Gefährliche, das Dämonische: was die Klarsicht bedeuten kann, vermischt mit wirren Träumen des Begehrens. Sterben, um dem nahe zu sein, was wir nicht leben. Der rumänische Aphoristiker E. M. Cioran kommt mir in den Sinn, der die Idee des Selbstmords für die einzig gute Idee hielt. Diesen aufzuschieben, sei freilich die noch bessere Idee. So werde jeder gelebte Augenblick zur Befreiung: Es bleibe mindestens eine Option offen.
Man liest so ein Buch und fühlt einmal mehr, dass der Erinnerung an Gestorbene die Frage eingeschrieben bleibt: Bedenke ich beim Gedenken, ob ICH wirklich - LEBE? Wir sind Eingetaktete, ausgestattet mit trainierter Selbstberuhigung: Ja ja, später ... wenn einmal Zeit sein wird, aber dann ... Zeit? Sie wird nie sein. Jener Satz, es sei für das wahrhaft Lohnende nie zu spät - das ist eine der bösesten Lügen. »Beginnen kannst du mit dem letzten Atemzug«, dichtet Brecht und lügt kräftig mit. Das Leben ist nicht wirklich Gelingen, es ist nur immer die kurzfristige Gelegenheit dazu.
Tod bedeutet Verhältnislosigkeit, sagt die Forschung - Existenz sei demnach das schöne reiche Gegenteil: Beziehungsreichtum. Der Tod tritt daher schon dann in Erscheinung, lautlos mitunter wie der Sand einer Uhr, wenn Beziehungen brechen, fehlen, verwehen. Um Beziehungen zu stören, hat der Tod viele Namen: Gewöhnung, Anpassung, Selbstgewissheit, Perfektion, Gier, Geltung, Macht. Der Tod ist in diesem Kampf gegen Beziehungen ein verflucht geschickter Stückwerkmeister; Tag für Tag, Augenblick für Augenblick - da ein wenig Vernichtung, und dort. Aber: Wo Beziehungen dauern dürfen, da ist man schon weniger tot mitten im Dasein, da hat das Wort »tot« zwei eingebaute Buchstaben mehr und wird so: Trost. Zwei Buchstaben, welch ein Gewinn. Zwei Buchstaben. Wie das Ja - zum Leben.
Auf Friedhöfen glauben wir ein wenig ans Undenkbare: verschont zu bleiben. Es ist ein Glaube aus reiner Not, nichts ändern zu können - denn du bist nicht unsterblich, nur weil du dich unsterblich verlieben darfst. Aber Not ist der Geburtshelfer für diese schönste Beschäftigung: zu glauben. Beispiele? Wo die Not am größten ist, ist der Glaube an die bessere Welt am kräftigsten, am ehrlichsten wohl auch. Wo die Einsamkeit am ärgsten ist, malt der Glaube an Zweisamkeit die tollsten Bilder. Fünf vor zwölf schlägt die feurigste Stunde der Utopien. Wo Schuld dich am heftigsten plagt, möchtest du ebenso heftigst daran glauben, Unschuld sei wieder möglich. Wir glauben, was nicht ist. Auf diese Weise ist es. Obwohl es vielleicht niemals wird. Gäbe es Gott, müsste man ihn nicht glauben. Glaube ist ein Blick durch Risse in der Vernunft. Es ist jener Blick auf das Unmögliche - den wir aber brauchen, weil uns das Mögliche dauernd enttäuscht. Denn möglich ist nur immer Lösung, statt Erlösung; Heilung statt Heil; Befriedung statt Frieden. Und so glauben wir auch am innigsten ans Leben, wo uns seine gnadenlose Kürze und Unwiederholbarkeit bewusst wird.
Leben ist Diesseits. Und das Diesseits ist Mäßigung und Mäßigkeit, Ordenspflicht und Ordnungssinn; alle Schönheit limitiert, dazu diese lastende Deckungseinheit von Welt und Provinz. Da braucht es ein Jenseits, auf das man hoffen darf. Ein Leben jenseits, aber doch: eines lang vorm Tod. Leben jenseits der uns aufgezwungenen Einsicht in den schmalen Lauf der Dinge, darin wir uns täglich so elendig erledigen. Dagegen wehrt sich Glaube. Der Glaube daran, man könne sich das Leben nehmen. Es sich hernehmen. Es annehmen. Es mit ihm aufnehmen. Es in Anspruch nehmen. Es in Schutz nehmen. Es sich herausnehmen. Lebensfreude besteht dann nicht darin, jeden Tag wie gefordert zu Ende zu bringen; Lebensfreude ist, jeden Morgen unaufgefordert, aber fordernd ein Anfänger zu bleiben. Das halte einer durch! Da bedarf es der Zuversicht. Sie kann aus dem, der ihrer bedarf, nicht herauströpfeln, sie muss dem Bedürftigen zufluten. Und keiner muss genau wissen, woher. Ganz im Sinne Friedrich Hölderlins, der im »Hyperion« sagt: Wenn er träume, sei der Mensch ein Gott; wenn er nachdenke, nur ein Bettler.
Immer wieder hat es Dichter gegeben, die versuchten, den Übergang zum Tod zu beschreiben: »Und ein Stein zwischen Steinen, ging er in der Freude seines Herzens wieder in die Wahrheit der unbeweglichen Welten ein.« Albert Camus. Oder Arthur Koestler: »Das Meer war wieder um ihn, und die Geräusche des Meeres. Eine Welle hob ihn langsam hoch, kam von ferne und reiste gemächlich weiter, ein Achselzucken der Unendlichkeit.« Unser Versuch, das Unerfassliche fantasierend zu übersteigen - es befreit uns, gleichzeitig verstrickt es uns nur tiefer ins Ohnmächtige, Ausgesetzte, Zufällige unserer Existenz, der kein wirkliches Ergründen ihrer selbst gegönnt ist. Im Augenblick eines Todes ganz, ganz in unserer Nähe, wird der Sinn, dem wir unserem Leben bis dahin gaben, sehr nichtig, aber später begreifen wir wahrscheinlich die Paradoxie: dass dieser Sinn im Augenblick des fremden Sterbens seine wichtigste Geburtsstunde hatte - es beginnt das Überleben, im Bündnis mit dem Schmerz.
Schmerz ist, als rase unser Kopf gegen jene Membranwand zwischen dem, was wir fassen können, und dem, was uns in größerem Maße umfasst. Also was die Welt sich weitergibt von Stern zu Stern, draußen im Kalten, dessen kleiner Teil wir sind. Nur ein kleiner Teil, ja, durch Bewusstsein kurzzeitig erhitzbar, ehe auch er unauffindbar ins Kalte zurücksinkt. Es kann die unglücklichste Macht sein, die ein Mensch über den anderen Menschen ausüben muss: dieses Überleben. Überleben ist Unglück, wie es auch Glück ist. Beides ununterscheidbar. Die Kraft des Todes, uns Tränen zu entlocken, trifft sich mit dem Angebot des Lebens, sie zu trocknen.
Ja ja, sagen die Aufgeklärten und wiederholen gern den fühllosen Satz, der Tod gehöre nun mal, ganz natürlich, zum Leben. Der Satz ist eine Infamie, wie fast jede Wahrheit. Sage einer diesen Satz doch bitteschön laut und heiter und einverstanden, wenn er die Sonne sieht, die Wolken, den Schnee, ein geliebtes Gesicht, das lebendige Treiben, die Kindeskinder oder sich selber in gemütsstärkendem Tun! Sage einer in so einem Moment: He, Leute, ein Prost auf die Vernunft und den Materialismus - der Tod gehört nun mal zum Leben! Nein, da hilft keine Vernunft: Der Tod kommt als Feind zu uns, sagte Elias Canetti. Sterben zu müssen, das bleibt neben der Unumstößlichkeit, dass der Mensch mit Lebensbeginn unrettbar schuldig wird, der einzig wirkliche Skandal, den es gibt!

Mehr Infos auf www.dasnd.de/genossenschaft
Linken, unabhängigen Journalismus stärken!
Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.
Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.