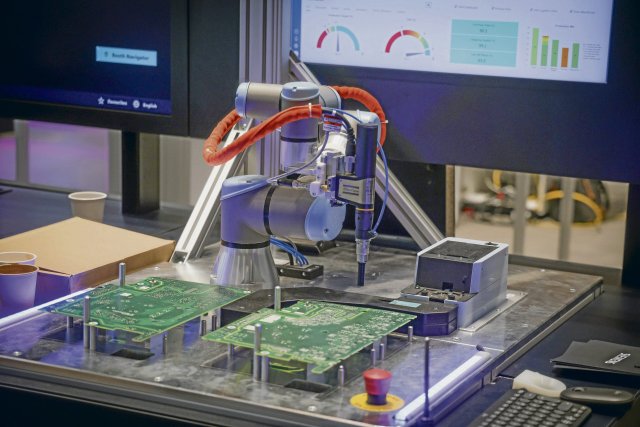Brot, Butter und Bürokratie
Genossenschaftsbanken rechnen wegen »Regulatorik« mit mehr Fusionen
Gebranntes Kind scheut das Feuer: Das gilt auch für Banken. Weil die Finanzkrise nicht zuletzt durch die ungezügelte Vergabe unzureichend gesicherter Kredite ausgelöst wurde, geht man in Europa künftig auf Nummer sicher. Ab 2017 muss eine Bank, die einen Kredit vergibt, bis zu 110 Daten an die Europäische Zentralbank (EZB) übermitteln - ab einer Kreditsumme von 50 000 Euro. »Das Meldewesen explodiert«, sagt Horst Kessel, Vorstandsmitglied im Genossenschaftsverband: »Das sind unzumutbare Verhältnisse.«
Das gilt nicht nur mit Blick auf den Datenschutz, sondern auch auf die Rentabilität der Institute. Die 300 im Verband organisierten Volks- und Raiffeisenbanken leiden zunehmend unter regulatorischen Vorschriften, mit denen Lehren aus der Finanzkrise gezogen werden sollen - einer Krise, »die nicht durch uns verursacht wurde«, betont Kessel. Die Regulierer aber machen keine Unterschiede; neue Regeln gelten für alle Geldhäuser. Viele Vorschriften traten 2014 und 2015 in Kraft. Die Folgen für Genossenschaftsbanken wiegen schwer, sagt Kessel: »Wir müssen uns nach der Decke strecken.«
Auf die Banken kommt viel zusätzliche Arbeit zu. Ein Beispiel: Seit Anfang Januar sollen sie nicht nur Geldscheine, sondern auch alle Münzen, die auf den Tresen und in den Automaten landen, auf Echtheit prüfen - enormer Aufwand. Auch dehnen Vorschriften zur Protokollierung die Gespräche zur Anlageberatung sehr in die Länge. Zudem brauchen die Institute immer mehr Spezialisten mit speziellen Fremdsprachenkenntnissen. Bei einer Umfrage des Verbands klagten denn auch fast 30 Prozent der Institute, die Regulatorik sei eine große Belastung.
Vor allem bei kleinen Banken bedroht sie sogar die Eigenständigkeit. »Es wird sehr schwer, alle Anforderungen allein zu erfüllen«, sagt Wolfgang Schuster von der Volksbank Delitzsch, einem Haus mit 60 Mitarbeitern und 300 Millionen Euro Bilanzsumme. Noch stemme man sich gegen die Flut an Forderungen, aber »in dieser Übertreibung erstickt es jeden«, sagt Schuster. Mit seiner Sorge ist er nicht allein: 46 Prozent der Umfrageteilnehmer rechnen mit einer Fusion im Zeitraum bis 2019.
Die Welle rolle bereits an, sagt Kessel. Über sieben bis acht Jahre war die Lage dank guter Erträge recht stabil; im Schnitt gab es fünf bis sechs Zusammenschlüsse von Instituten pro Jahr. 2014 stieg die Zahl auf zwölf; 2015 wurden allein bis März sechs Fusionen angemeldet. Aus der Politik gebe es zwar bereits erste Signale, dass an der Notwendigkeit einzelner Maßnahmen gezweifelt werde. »Aber vom ersten Reflex bis zur Umsetzung dauert es eine halbe Dekade«, sagt Kessel. Kurzfristig sei daher nicht damit zu rechnen, dass der Fusionsdruck abnehme.
Für die Genossenschaftsbanken ist das um so fataler, als Regionalität zum Erfolgsrezepte gehört. Bisher funktioniert das gut, wie das Beispiel Sachsen zeigt. Den dortigen 18 Banken kamen zwar 2014 einige Kunden abhanden; die Zahl sank um 4000. Auf den Konten der verbleibenden 630 000 Kunden aber lagen 7,37 Milliarden Euro, 383 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Zudem wollen immer mehr Kunden auch Mitglied ihrer Genossenschaftsbank werden - ihre Zahl stieg um 1,7 Prozent auf 196 399. Vielleicht liegt das an der Dividende, die gezahlt wird; vielleicht aber auch daran, dass Menschen seit der Bankkrise ihr Geld lieber bei Banken anlegen, die sich nach Kessels Worten auf das »solide Brot-und-Butter-Geschäft« konzentrieren statt auf riskante Geldanlagen. Auch Kunden von Banken scheuen womöglich inzwischen das Feuer.

Wir behalten den Überblick!
Mit unserem Digital-Aktionsabo kannst Du alle Ausgaben von »nd« digital (nd.App oder nd.Epaper) für wenig Geld zu Hause oder unterwegs lesen.
Jetzt abonnieren!
Linken, unabhängigen Journalismus stärken!
Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.
Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.