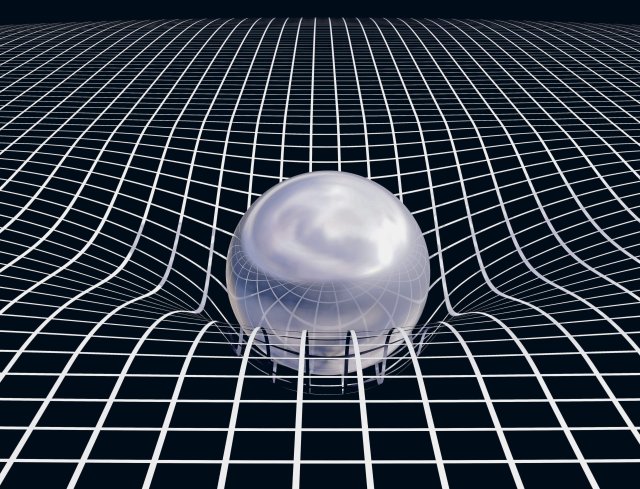Wie viel Jenseits braucht das Diesseits?
Den Weltuntergang träumen – so kommt das Leben zu sich selber
Die Frau liegt nackt auf einem Felsen. Die letzte Form der Hingabe: Opfergabe sein. Hell strahlt der Körper - im Licht des Sterns Melancholia, der auf die Erde zurast. Die Frau streicht sich über den Körper, ein Zeichen plötzlicher Ausgeglichenheit - einer doch sehr überraschenden Ausgeglichenheit, angesichts der manischen Depressionen und des bevorstehenden Todes. Lars von Triers Film »Melancholia« von 2011: die Planetenfusion als ultimative Crash-Fantasie eines Melancholikers.
An diesen Film fühlt man sich bei der Lektüre des soeben erschienenen sprachbetörenden Romans »Winters Garten« der jungen Österreicherin Valerie Fritsch erinnert. Im Buch geht ebenfalls die Welt unter: »Schon prasselten die Witwenhäuschen im Feuer, und schon fiel der Schnee wie Schrot. Schon schrieen die Pfauen im Quecksilbergesang. Schon brannten die Puppenküchen. Schon standen die Wälder voller Geigen. Schon tobte das Meer, und schon verstummten die Tiere. Schon zerbrachen die Eierschalen. Schon fiel der schwarze Vorhang. Schon wurde es nicht mehr hell.«
Und noch eine Neuerscheinung: »Der Tod und das Leben danach« heißt das Buch des US-Philosophen Samuel Scheffler. Er fragt spekulativ nach den Veränderungen unserer Existenz, wenn wir plötzlich erführen, dass dreißig Tage nach unserem eigenen Tod überhaupt alle Existenz auf der Erde verlöschen würde. Lebten wir weiter wie bisher? Entwickelten wir ein ganz neues Verhältnis zum eigenen Sterben? Wie sähen wir auf unsere Lieben, mit dieser unbedingten Gewissheit, dass sie uns bald folgen? Welchen Sinn hätte jetzt noch ein tätiger Einsatz für Visionen?
Apokalyptische Vorstellungen gab es schon immer, auf trivialliterarischer Ebene wie in den Höhen der Philosophie und Kunst. »Aber es gibt einen merkwürdigen, auffälligen Zuwachs an Endlichkeitsbefunden«, schreibt Scheffler, »als dränge es den allwaltenden Geist, nach langen Perioden des ungebremsten utopischen Denkens nun zu einer mäßigenden Balance zurückzukehren«. Bezogen auf den einzelnen Menschen, wird es diese Balance wohl nie geben. Wir wissen um unser Verwittern und Verschwinden, und doch beschwört jede Liebe zum Leben dessen Verlängerung; jede Erfüllung will Ewigkeit, und erst die Steigerung eines Leids ins Unerträgliche kehrt den drängenden Wunsch nach einem Ende des Schmerzes - möglicherweise - um in den Wunsch nach einem Ende gar des Lebens.
Das Sachbuch Schefflers wie der Roman Fritschs lassen sich, bei aller Grobheit dieses Verfahrens, auf einen gemeinsamen Gedanken bringen: Die Gewissheit des Sterbenmüssens gibt unserem Leben Kontur - so, wie diese Gewissheit zugleich Ängste, Trotzfiktionen und Glaubensbeschwörungen auslöst; und wie wir das Sterben begreifen und erfahren werden (unberechenbar hereinplatzende Unglücke ausgenommen), das hat grundsätzlich immer mit den lebenslang verteilten Quanten an Liebe und Geborgenheit zu tun.
Von einer »heiligen Kinderzeit« schreibt Valerie Fritsch, in der ihr Romanheld Anton »nichts anderes lernte, als ein großer Mensch zu werden und am Ende so klein zu sein wie alle anderen und keine Angst davor zu haben«. Das, lapidar erfasst, ist sie: die wünschenswerte Aufgehobenheit in einem Kreislauf, der Einfalt und Vielfalt zusammenschaltet - die Einfalt, sich eines Anfangs und eines Endes bewusst zu sein, und die Vielfalt der Erfahrungen dazwischen. Erfahrungen, die möglichst gehalten werden mögen vom Band einer früh erfahrenen und immer wieder erneuerten Zugehörigkeit. Egal, was passiert und unabhängig davon, welche Konfliktschneisen das Leben schlägt? Das wäre es, das mögliche Glück.
Erfahrung, das ist die Schnittfläche von Realitätsverarbeitung und gleichzeitiger Realitätszufuhr. In Erfahrung bewege ich mich, springe in ein Mehr, dem freilich nur immer fragmentarisch zu begegnen ist. Wer handelt, öffnet sich einer Möglichkeit, indem er andere Möglichkeiten abwürgt. In Erfahrung wird sichtbar, wie die eigene Seele lebt, wovon sie sich ernährt. Auf die Dauer kommt es an den Tag, was im Leben gute Absichten oder nur falsche Rücksichten waren, ob ich von mir selber erpressbar und damit für Erpressungen von außen anfällig war; es kommt zum Vorschein, in welche Richtung in mir die Balance zwischen Natur und Kultur ausschlägt, und ob Lebenskraft wirklich Charakter oder nur müde gewordenes Temperament war. Was ist die späte, bilanzierende Behauptung eines selbstbestimmten Lebens wert, wenn sie die Wahrheit von Selbstbetrug und Selbstdeformation verdrängt? Irgendwann wird also offenbar, wie viele Tode man in der menschlichen Reife gestorben ist und welche kleinen Auferstehungsschritte zu sich selbst man verweigert, verpasst oder aufgeschoben hat.
Auferstehung? Ja. Indem man sich an die Lust heranlebt, nicht mehr überall dabeizustehen, nicht mehr an jedem Angebotsort anzustehen, nicht mehr alles durchstehen und nicht mehr irgend jemandem vorstehen zu wollen. Die Dinge sich setzen lassen, das ist Auferstehung. Loslassen ist: die Anstrengungen sterben lassen - im Dienst des (verbleibenden) Lebens. In einem Synonymwörterbuch fand ich für: »Das Zeitliche segnen« die Bedeutung: »defekt werden«. Defekt werden für Überforderungstechniken. Das Zeitliche segnen heißt dann: Meine begrenzte Zeit kehrt in einem ewigen »Nur jetzt« zu sich selber heim. Beruhigt. Erhellt von etwas, für das man die Furcht vor dem Tod, vor dem Untergang, als Erwachensmoment geradezu braucht.
Ging man nicht immer an einer Wand entlang? Die würde, dachte man, aufhören, und dann begänne das Leben, die volle Berührung also. Das war ein Irrtum. Die Wand war das Leben. Jetzt lehn dich an und fühl dich gesammelt. Mit sich Frieden schließen, ja, aber doch bitte im Einverständnis mit dem Schrundigen, das in uns spurt. Und wohl dem, der am ahnbaren Ende seiner Tage nach jenem letzten Wort, das er für den Frieden mit seinem Leben benötigt, nicht allein, nicht einsam suchen muss.
Wenn in Schefflers Buch die Frage nach den Änderungen der individuellen Existenz aufgeworfen wird, angesichts eines nahen Endes sämtlicher Lebensformen, so ist damit auch ein spezielles Problem des Menschen aufgeworfen, der, zum Beispiel, für die Utopie einer kommunistischen Welt streitet, kämpft. Wie vertragen sich Ferne einer Idee und Endlichkeit eines Einzelnen? Jede Utopie ist ein gedanklicher Überschuss unseres Bewusstseins. Dieser Überschuss entzündet sich am Elend der Systeme. Ist spiritueller Glanz überm Grau. Ist geistiger Wärmestrom gegen die praktische Raserei der konkurrierenden Zwecke. Die bessere Welt denken, das ist Glauben an etwas, das man selber nie erfahren wird.
Glaube ist der Blick durch die Risse in der relativierenden Ratio. Es ist jener Blick auf das Unmögliche, den wir brauchen, weil uns das Mögliche dauernd enttäuscht. »Ich lebe im Schmerz, ein künftiger Toter zu sein, und es ist mein Antrieb«, schrieb Camus. Also: Gäbe es den Tod nicht, würde uns nichts wirklich bewusst werden. Wir würden anders, lebloser, vielleicht gar nicht über die Freuden und Gefahren der Kindheit und Jugend und der »besten Jahre« und des Alters sprechen, wenn nicht jeder dieser Abschnitte in Beziehung, in Kontrast, in Abschied zu anderen Phasen unseres Leben stünde.
Gesundheit, Krankheit, Gewinn, Nutzen, Risiko, ja Liebe und Hass - alle Wertzuweisungen ergeben sich als Reaktion auf zeitliche Grenzen. Das ist das Zerrpunkt unseres Bewusstseins: Wir sehen das ein - und fürchten uns dennoch vor dem Tod. Samuel Scheffler nennt diese Angst vorm Tod sogar »vernünftig«. Denn sie ist nötig, um unser Vertrauen in die Bedeutung dessen zu erhalten, was wir wertschätzen. Jede Entscheidung unseres Lebens treffen wir im Bewusstsein von Kostbarkeit. Liebe, Zusammengehörigkeit, Sinn - das ist Kostbarkeit, die ihr jeweiliges Leuchten nur aus dem (schmerzlichen wie spornenden!) Wissen um deren unabänderliche Vergänglichkeit erfährt. Unsere Angst vorm Tod, so Scheffler, zeugt »von der Tiefe unseres Vertrauens in den Wert all dessen und von der Gebundenheit an das, was durch den Tod dann leider sein Ende findet«.
Erst die Vorausahnung des Verlusts bindet Sinn und Sinne an die Sehnsucht nach Beständigkeit. Die Kraft des Todes, uns Tränen zu entlocken, trifft sich mit dem Angebot des Lebens, sie zu trocknen.
Tod bedeutet Verhältnislosigkeit, sagt Scheffler - Existenz sei demnach das schöne reiche Gegenteil: Beziehungsreichtum. Der Tod tritt also schon dann in Erscheinung, lautlos mitunter wie der Sand einer Uhr, wenn Beziehungen brechen, fehlen, verwehen. Um Beziehungen zu stören, hat der Tod viele Namen: Gewöhnung, Anpassung, Selbstgewissheit, Perfektion, Gier, Geltung, Macht. Ja, auch: Erfüllung. Wo Beziehungen dauern dürfen und neue Erfüllung ersehnt wird, da ist man schon weniger tot mitten im Dasein.
Am Schluss des Filmes »Melancholia« wie im Roman von Valerie Fritsch tritt Ruhe ein, tiefe, verstörende Ruhe. Nur ein kleiner Junge hat bei Lars von Trier noch Angst. Seine Mutter wird ihm einen Wigwam bauen, eine Zauberhütte, in der keinem etwas geschieht. Dort sitzen sie, um einen letzten Augenblick der Nähe zu erleben. Kunst, Fantasie sind nichts anderes als jene Hütte einer eingebildeten Furchtlosigkeit, bevor der Wahnsinn unserer Existenz uns ereilt. Das war’s. Dann ist alles aus. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. »Nachdem die Welt untergegangen war«, heißt es in Valerie Fritschs Roman, »spielte es in Anton Winters Träumen Joy Division und Rachmaninow am Morgen.«
Samuel Scheffler: Der Tod und das Leben danach. Aus dem Amerikanischen von Björn Brodowski. 154 S., geb., 19,95 €. Valerie Fritsch: Winters Garten. 154 S., geb., 16,95 €. Beide im Suhrkamp Verlag Berlin.

Zum Aktionspaket
Linken, unabhängigen Journalismus stärken!
Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.
Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.