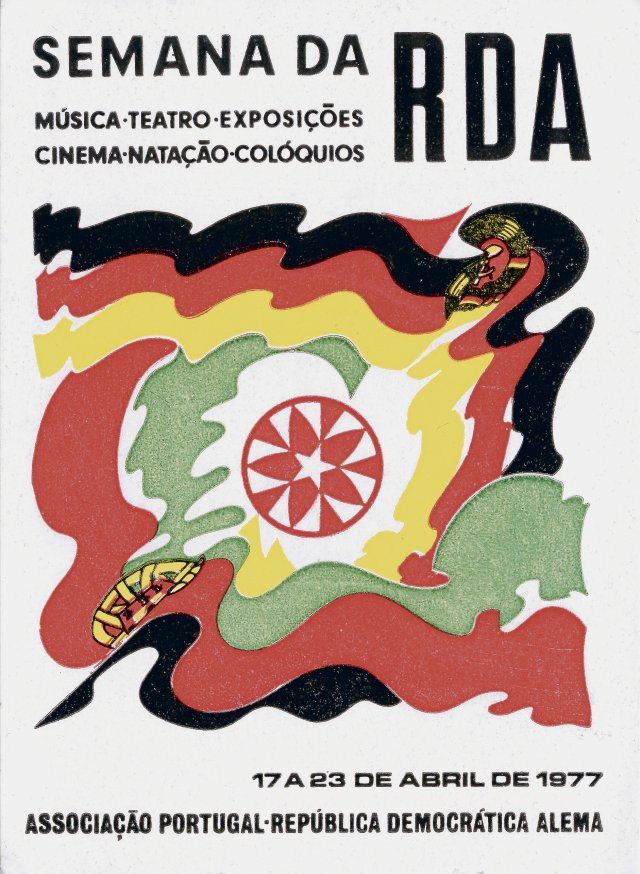In dieser Welt, nicht von dieser Welt
Bernhard Schlink als Gesprächsgast von Gregor Gysi im Deutschen Theater Berlin
Dass der Mensch in einem einzigen Leben mehrere Existenzen führen darf - diese Chance ist nicht nur das gefährliche Privileg des Spions, sie beschränkt sich keineswegs auf die Verwandlungsgaben des Schauspielers, und sie erschöpft sich auch nicht im hysterischen Modesport der fortwährenden Identitätssuche. Sich innerhalb des mehr oder weniger festgelegten Daseins in erquickendem Maße frei und flexibel zu bewegen, sich in unvermeidlichen Gewohnheitszwängen nicht selber noch zusätzlich festzuzurren - es ist schlichtweg das Gebot bewusst geübter Lebenskunst. Wenn Gregor Gysi allmonatlich, bei seiner so erfolgreichen Gesprächsreihe, die Bretter des Deutschen Theaters betritt, sieht man ihm diese Freude am Wechsel, am Entronnensein, an der Aus- und Anderszeit regelrecht an. Lust am Wechsel vom Bundestäglichen ins Bühnenbesondere; Spaß am Entronnensein aus fraktioneller Geistesart und linker Orthodoxie; Genuss an der Auszeit von Parlamentsrhetorik, also Genuss an der Anderszeit im Parlieren und Plaudern. Erfolg in der Politik ist offenbar an die Fähigkeit gebunden, den Ehrgeiz des Einsatzes sichtbar mit der Gelassenheit des Spiels zu verbinden.
Spielerisch freilich wirkte er auf den ersten Blick kaum, der diesmalige sonntägliche Gesprächsgast: Schriftsteller Bernhard Schlink, Jahrgang 1944, Autor des Weltbestsellers «Der Vorleser», viele Jahre Professor des Rechts und der Rechtsphilosophie in Bonn und Frankfurt am Main, 1989 Verfassungsexperte am Runden Tisch in Berlin, Nachwendepionier an der neu zu gestaltenden Humboldt-Universität. Der Mann ist ganz und gar graugelockte Verhaltenheit, er offenbart wohlüberlegte Ausschmückungsscheu. Nur kein Wort zu viel; das Denken in provokanter Distanz zum Sprechen. Einerseits ein Problem des Vormittags, andererseits ein Konzentrationsimpuls.
Aufgewachsen ist Schlink in Heidelberg, in einem Pfarrhaus. Abends die Bibelauslegungen, der Vater liebte die Briefe-Kapitel, «ich mochte eher das ›Buch der Könige‹, das war Sex und Crime pur.» Ein Leben, «kulturvoll und religiös», bis heute wirken die Choräle Bachs. Der so geniale Komponist, von dem man sagen darf, solche Musik habe Gott aufgelegt, als er die Welt schuf. Gysi zitiert, als Frageneinstiege, immer wieder schöne Sätze von Schlink, etwa diesen: «Ich bin in der Welt, aber nicht von dieser Welt.» Aufrufungen des Eigensinns; betont nüchtern betreibt sie der Schriftsteller, nur bloß keine Pose, nur ja keine Emphase bei Dingen, die selbstverständlich sind, und du hörst das Selbstverständliche und weißt sofort, wie schwer, wie mühsam es zu erringen und durchzuhalten ist.
Literatur und Jura? Eine Liaison? Unbedingt. Schlink erzählt von US-amerikanischen Methoden (übertragenswert für Deutschland), Rechtsphilosophie nicht mittels der «trocknen, schweren Klassiker» zu lehren, sondern am Beispiel der Dichter: Kleist, Dostojewski, Kafka. Warum? Schlink sagt es nicht, Gysi fragt es nicht, aber es ist wahrscheinlich ganz einfach: Dichter wollen am wenigsten recht haben. Rechthabenmüssen, diese Krux der Politiker, der Leitartikler, der Parteien, überhaupt: der Tonangebenden, welcher Art und welchen Betriebs auch immer.
Schlink hat ein Haus in den USA, liebt «die Offenheit, die Zuwendungsfreude, die Neugier der Amerikaner», lässt sich davon nicht abbringen, «obwohl die gegenwärtigen politischen Verhältnisse schrecklich» sind. In den USA übrigens absolvierte er eine Ausbildung als Masseur - herrliche Reaktion auf einen Überdruss damals: «Ich war der Worte müde.» Aussage eines in sich Ruhenden, der Sinn für den Ausgleich hat. Der Gegenpart zu den Workaholics. Gysi schaut Schlink an, der eher Kleine den großen Hageren. Masseur? Wo ist denn da die Knet-Masse? Schlink sagt, wer geschickt mit der Schwerkraft arbeite, erziele Effekte, für es keiner derben Kraft bedarf. Genau so, wie der Dichter gleichsam mit der Zartheit der Feder, die einst übers Papier kratzte, ganze Welten erstehen lässt.
«Der Vorleser», die Geschichte der KZ-Aufseherin, der Analphabetin, die sich in einen Jungen verliebt - der somit von einer der quälendsten, unerträglichsten Spannungen getroffen wird, dem Zerren zwischen Schuld und Vergebung, zwischen Aburteil und Verständnis, zwischen der Unbarmherzigkeit der Wahrheit und tiefer Zuneigung. Schlinks bleibendes Thema: die Schatten des Gestern, «erst wird Vergangenheit gnadenlos angerichtet, dann gnadenlos bewältigt.» Ein Mann der Mitte, das spürt man, «ich bin kein linker Sozialdemokrat, aber ein Sozialdemokrat». Das heißt für ihn: «Partei ergreifen für die soziale Durchlässigkeit der Gesellschaft». Das rebellische Aufmerken der Achtundsechziger hielt er für nötig, ihr militantes Demo-Auftrumpfen («Ho-ho-ho-chi-minh!») stieß ihn ab, und am Ende stand mit Schröder und Fischer «eine »erschöpfte Generation« am Staatsruder, es waren die »Versager einer von links kommenden Bewegung«. Das Linke heute? »Na, Ihre Partei ist ja auch ein wilder Haufen.« Gysi schmunzelt. Prinzipiell, so Schlink, agierten Linke auf Praxisfeldern der Sozialkritik, aber »geistig ist das linke Feld leer, da ist gedanklich, konzeptionell nichts mehr, was eine Welt tragen oder überhaupt viele Menschen locken könnte.« Was demokratischer Sozialismus sei? Schlink: »Weiß ich nicht.« Gysi: »Ich weiß es auch nicht, und es ist gut so. Jede Definition schneidet Wege ab«, jeder Schritt einer Transformation - und nur dafür stehe er - führe zu neuen Optionen, die dann wieder neue Ideen und Entscheidungen auslösten.
Schlink erzählt von einer Freundin aus der DDR, der er in den sechziger Jahren (mit 5000 DM für gefälschte Ausweispapiere) Fluchthelfer in den Westen war. Erzählt von der ersten Fahrt mit einem »Trabant« - der natürlich bald stehenblieb, weil der Westdeutsche keinen Benzinhahn kannte. Nein, Richter wollte er nie werden, »ich möchte nicht über Menschen richten müssen.« So, wie das der Schriftsteller auch nicht tut. Schlink konstatiert, dass »Parteien auf Orts- und Kreisebene so langweilig sind, dass man sofort weggehen muss, um nicht krank zu werden«. Er hält es für das Elend der Politik, dass selbst nötigste Kursänderungen immer nur erzwungen werden müssen, »nichts geschieht freiwillig, so, wie der Mensch generell heute am liebsten nur das tut, was er gestern und vorgestern tat«.
Die DDR nennt der Autor eine Ordnung, die die Bundesrepublik zu sozialer Wachsamkeit gezwungen habe, und überhaupt sei der Kalte Krieg trotz aller Unbill ein Zustand mit regulierendem Einfluss gewesen - heute stehe der Deregulierung und einer hemmungslosen Globalisierung der Kapitalkräfte leider nichts Korrigierendes, Mäßigendes mehr entgegen. Man darf da wohl an Botho Strauß denken, der sich sarkastisch nach einem »panislamisches Reich vom Sudan bis nach China« sehnte. »Hätten wir es schon! Ein kalter Krieg wäre wieder möglich. Also Bedrohungspotenziale. Also Waffenruhe.« Also gegenseitige Vorsicht. Also Vorsicht, weil es Gegenseiten gibt.
Schlink erzählt vom dringlichen Rat seiner Mutter, er müsse »nützlich« sein. Nein, im Nutzen möge sich der Mensch, um Gotteswillen, nicht genügen. Deshalb die Hinwendung zur Literatur? Ja. Und nein. Denn nach seinen großen schriftstellerischen Erfolgen blieb Schlink doch in seinem Lehrberuf. Aus gutem Grund: »Mir ist es wirklich ums Recht«, sagt er knapp und definiert eine Lebenshaltung - hilfreich auf einem Gebiet zu arbeiten, mit dem alle Menschen zu tun haben. Also doch: nützlich sein. Schönstes Nützlichsein: der bedrückten Seele juristisch so sehr zu dienen, wie Kunst der sehnsuchtsvollen Seele dient.
Ein sprödes Gespräch. So, als bringe Bernhard Schlink ein Quäntchen Misstrauen mit auf die Bühne. Immer in Reserve: die schützende Kraft der Verschlossenheit. Aber so bedarf es während dieser anderthalb Stunden keines Draufzu und keines Drauflos; das Wesentliche muss nicht aufs Trampolin, und es pfeift kein Dampf, auch bei Gysi nicht. Und hinterwitzig lachen kann Bernhard Schlink auch.

Wir behalten den Überblick!
Mit unserem Digital-Aktionsabo kannst Du alle Ausgaben von »nd« digital (nd.App oder nd.Epaper) für wenig Geld zu Hause oder unterwegs lesen.
Jetzt abonnieren!
Linken, unabhängigen Journalismus stärken!
Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.
Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.