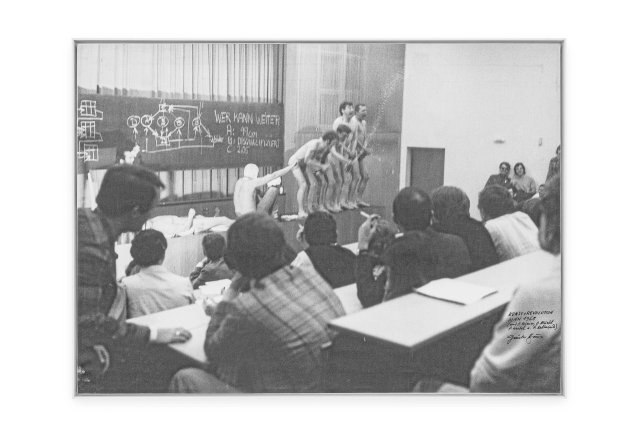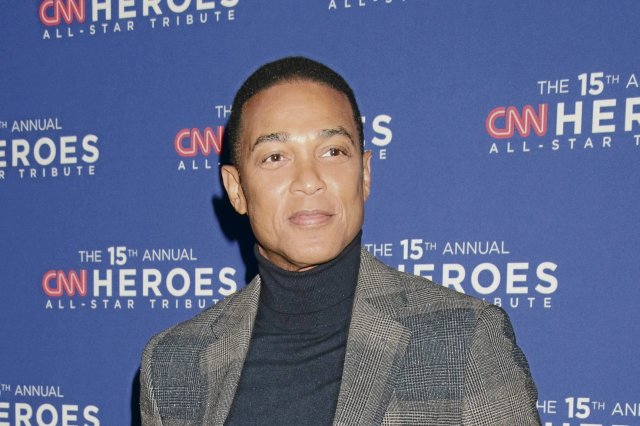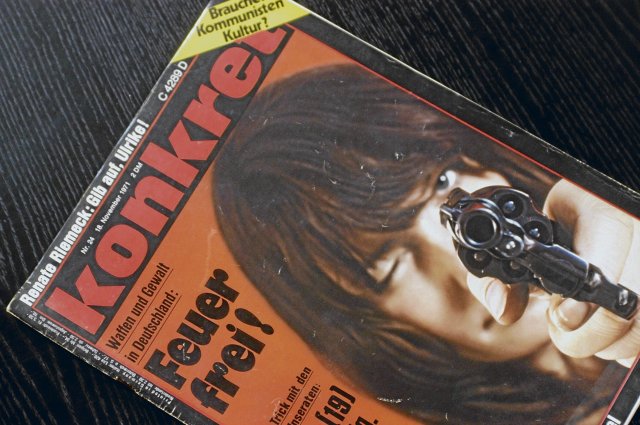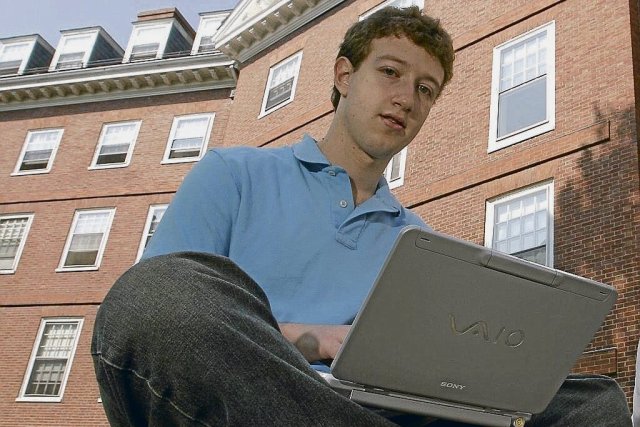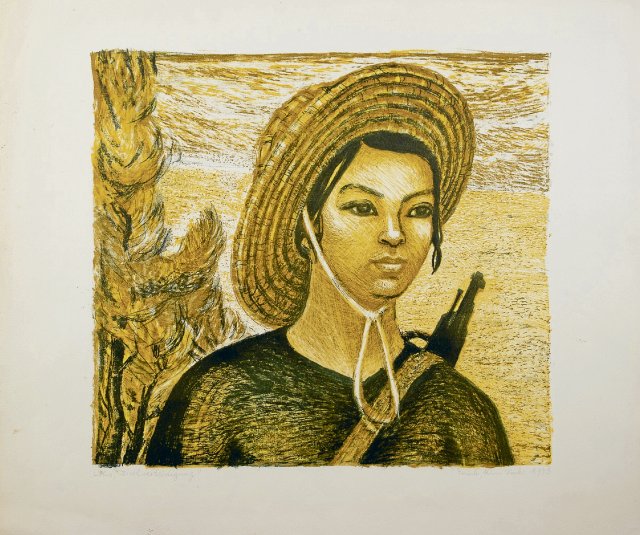Larissa Kunert
Larissa Kunert, 1990 in Itzehoe (Schleswig-Holstein) geboren, hat Literaturwissenschaft und Geschichte in Berlin, Hamburg und Lausanne studiert. Nach Stationen bei der »Jungle World«, dem Ventil Verlag und »Texte zur Kunst« sowie als freie Journalistin und Lektorin arbeitet sie seit 2022 als Redakteurin für Kunst und Medien für »nd«.
Folgen:
Aktuelle Beiträge von Larissa Kunert: