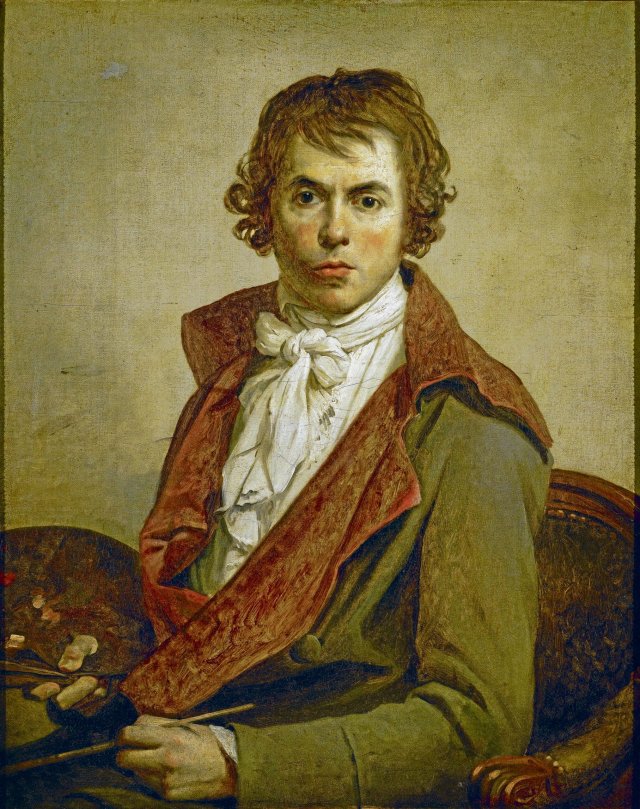Wenn es ernst wird, hört der Spaß auf
Warum Menschen Lust an der Angst empfinden - und bis zu welchem Punkt.
Von den magischen Wesen, die Joanne K. Rowling in der Welt ihres Zauberlehrlings Harry Potter angesiedelt hat, gehören die Irrwichte zu den interessantesten. Ein Irrwicht, so will es die Autorin, ist ein Gestaltwandler. Sein wahres Gesicht ist unbekannt. Wenn er jedoch aus seinem dunklen Versteck befreit wird und einem Menschen begegnet, erscheint er ihm als Verkörperung dessen größter Angst: als riesenhafte Spinne etwa oder als böswilliger Lehrer. Gefährlich sind Irrwichte nicht; gefährlich ist allein die Furcht, die sie heraufbeschwören. Wer um das Geheimnis weiß, kann einem Irrwicht seine Bedrohlichkeit nehmen - indem er ihn lächerlich macht. Durch den »Riddikulus«-Zauber, gepaart mit Vorstellungskraft, wird der Angsteinflößer zur Witzfigur: die Spinne auf Rollschuhen, der Lehrer in den Kleidern der Oma.
Sich seinen Ängsten freiwillig auszusetzen, kann beträchtliche Freude bereiten. Der ungarische Psychoanalytiker Michael Balint hat dieses Wechselbad konträrer Gefühle in den 1950er Jahren erstmals eingehend untersucht und in seinem Buch »Angstlust und Regression« beschrieben. Am ungefährdetsten lässt sich die »Angstlust« heute wohl im Schutz medialer Räume erleben: beim Ansehen eines schauerlichen Horrorfilms, beim Lesen eines blutrünstigen Kriegsromans, bei der begierigen Aufnahme von Katastrophennachrichten. Wer den »Thrill« unmittelbarer, nämlich auch körperlich, sucht, kommt etwa bei Achterbahnfahrten auf seine Kosten. Voraussetzung dafür, dass die »Angstlust« nicht in das pure Grauen umschlägt, ist freilich ein Grundvertrauen in die Stabilität der Umgebung: Man baut darauf, dass im Kinosaal jederzeit die Saalbeleuchtung eingeschaltet werden kann. Man geht davon aus, dass die Fahrgeschäfte im Erlebnispark den Sicherheitsstandards genügen.
Bei Mutproben und gewissen Spielarten des Extremsports wird die Grenze, bis an die man sich vorwagt, nicht mehr nur von der Umgebung, sondern maßgeblich vom Ausübenden selbst gesetzt. Hier wird es wirklich spannend, denn unweigerlich nähern wir uns dem Point of no return - dem Punkt, von dem an es kein Zurück mehr gibt. Je näher man ihm kommt, desto intensiver der »Thrill«. Aber wehe dem, der ihn überschreitet! Maßgeblich für das Konzept der »Angstlust« ist die einkalkulierte Möglichkeit der Rückkehr in den sicheren Hafen, ganz wie beim Kind, das sich fortstiehlt aus der Obhut der Eltern. Einprägsam hat das Balints Berufs- und Zeitgenosse Donald Winnicott formuliert: »It is joy to be hidden, but disaster not to be found.« (»Es ist eine Freude, sich zu verstecken, aber eine Katastrophe, nicht gefunden zu werden.«)
Was aber, wenn der Kontrollverlust nicht aus Selbstüberforderung resultiert, sondern aus einer grundsätzlichen Fehleinschätzung der Situation? Es gab Zeiten, in denen man sich zum Militär einziehen lassen und in den fragwürdigen Genuss haarsträubender Kriegssimulationen kommen konnte, ohne einkalkulieren zu müssen, wirklich auf dem Feld in Stücke gerissen zu werden. Ist das noch der Fall? Das schauernde Ergötzen an apokalyptischen Szenarien einer vermeintlich nahen Zukunft ist ein über alle Zeiten auftauchendes Phänomen, das gegenwärtig wieder Konjunktur feiert: Glaubt aber trotz all der begründeten Indizien tatsächlich jemand an den bevorstehenden Untergang? Das Nichteintreten der imaginierten Katastrophe, Voraussetzung des anhaltenden Empfindens von »Angstlust«, gehört zum Selbstverständnis der modernen Welt.
Angenommen, eine Harry-Potter-Figur würde gestalthaft mit ihrer größten Angst konfrontiert und ginge - irrtümlich! - davon aus, dass es sich nur um einen Irrwicht handeln kann: Der »Riddikulus«-Zauber bliebe katastrophal wirkungslos.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.