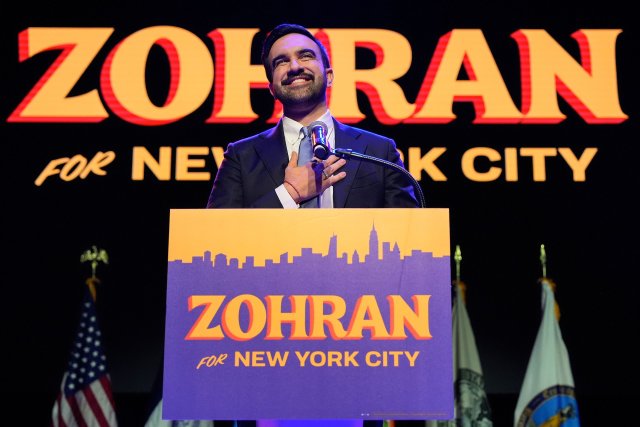Hilfe nur bei Suiziddrohung
Wegen der Ausgangssperre gibt es in Österreich psychische Unterstützung nur im Extremfall
Die Schulen praktisch geschlossen, die Kindergärten auf Notbetrieb, ein medizinisches System im Alarmzustand. Und während alles auf Infektionszahlen und epidemiologische Kurven schaut, beginnt der seit Mitte März anhaltende Total-Lockdown jetzt langsam aber sicher zu einem wirklichen Problem zu werden - vor allem für Jugendliche und Kinder. Es sind dann solche Antworten, die besorgte Eltern von Spitälern erhalten: »Solange ihr Sohn nicht droht, sich aus dem Fenster zu werfen oder Ihnen ein Messer an die Kehle hält, können wir nichts tun.«
Im konkreten Fall geht es um die Mutter eines Jugendlichen, der seit zwei Monaten an die Decke starrt. Seit Anbeginn der Quarantäne war er nicht aus dem Haus, zu Schularbeiten war er nicht zu bewegen, seit zwei Wochen hat er keinen Finger gerührt - nur unterbrochen von hasserfüllten Schreianfällen. Die alleinerziehende Mutter kontaktierte den Psychosozialen Notdienst in Wien, eine telefonische Anlaufstelle für Akutfälle - der verwies auf das Allgemeine Krankenhaus AKH in Wien, weil man selbst keine Diagnose stellen könne. Im AKH wiederum verwies man darauf, dass das Spital eben nur akute Notfälle betreuen und man keine Termine vergeben könne. Bei niedergelassenen Psychologen und Psychiatern ebenfalls der Verweis auf das AKH. So ging es wochenlang hin und her - bis das AKH jetzt schließlich wieder begann, Termine auszugeben. Bis dahin ist aber viel Zeit vergangen.
Am Willen zur Hilfe mangelte es dabei nicht. Ganz im Gegenteil: Im AKH stieß die verzweifelte Mutter auf offene Ohren und Verständnis - ebenso bei niedergelassenen Psychotherapeuten und Psychiatern sowie dem Psychosozialen Notdienst. Woran es anscheinend fehlt: am Stellenwert, den psychosoziale und psychotherapeutische Versorgung haben sollte.
»Es gibt genug Psychotherapeut*innen, die den Bedarf abdecken können«, sagt Barbara Haid vom Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie. »Was fehlt, ist die Finanzierung.« Sie glaubt, dass die »psychische Dimension dieser Krise« bisher »viel zu wenig auf der Agenda war«. Vor allem aber: Sie ist überzeugt, dass der Bedarf steigen wird - dass es zugleich aber aufgrund wirtschaftlicher Gegebenheiten weit weniger Menschen geben wird, die sich eine Psychotherapie auch leisten können. Und: dass die Krankenversicherungen mit dramatisch geringeren Einnahmen aufgrund hoher Arbeitslosigkeit letztlich eine sehr viel größere Menge an psychologischen Problemen zu meistern haben werden.
In Österreich sieht das System so aus: Die meisten Psychotherapeuten haben eine gewisse Anzahl voll finanzierter Kassenplätze. Darüber hinaus gibt es eine von der Versicherung getragene Teilfinanzierung - womit eine Stunde aber nach wie vor auf rund 60 Euro kommt. Barbara Haid fordert jetzt einen erleichterten Zugang sowie eine massive Aufstockung zu voll finanzierten Plätzen. Und das werde man vom Gesundheitsministerium auch einfordern. Aber ob sie da auf offene Ohren stoßen wird?
Auf die Normalisierungsmaßnahmen der Bundesregierung, also die langsame Öffnung des Landes, angesprochen, stellt es der eingangs erwähnten Mutter die Haare auf: Der Handel hat wieder offen, ebenso Nagelstudios oder Friseursalons. Aber die psychologische Betreuung? Die fährt erst langsam wieder hoch - nach Öffnung der Gastronomie am vergangenen Freitag.
Seitens des Gesundheitsministeriums hieß es zu dem Thema auf Nachfrage: Die psychologischen Dienste hätten nie schließen müssen. Die Betreuung habe im vollen Umfang zur Verfügung gestanden. Viele Dienste hätten auch ihr Angebot in Form von Telefondiensten aufrechterhalten. Die Reaktion der Fachfrau Haid: »Ohne einen Jugendlichen zu sehen, kann man keinen fundierten Befund erstellen.« Sprich: Wirklich behandelt werden könnten solche Probleme nur in direktem Kontakt.
Wovon seitens des Psychotherapeutenverbandes jedenfalls ausgegangen wird, ist ein massiver Anstieg des Bedarfs ab Herbst: mit einer Welle an Depressionen, Antriebslosigkeit, vermehrtem Substanzkonsum und in Folge Suchterkrankungen, Angststörungen, Panikattacken. Und je weniger darüber jetzt geredet werde, desto tiefer werde das Problem später einmal sitzen. »Bei Kindern und Jugendlichen muss investiert werden, das ist frühe Erste Hilfe«, so die Psychotherapeutin. Seit dem Lockdown bleibt die frühe Erste Hilfe aus.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.