- Wissen
- Biolumne
Künstliche Intelligenz verbessert Enzym
Bakterienenzyme, die Plastik abbauen, werden so umgebaut, dass sie effektiver arbeiten
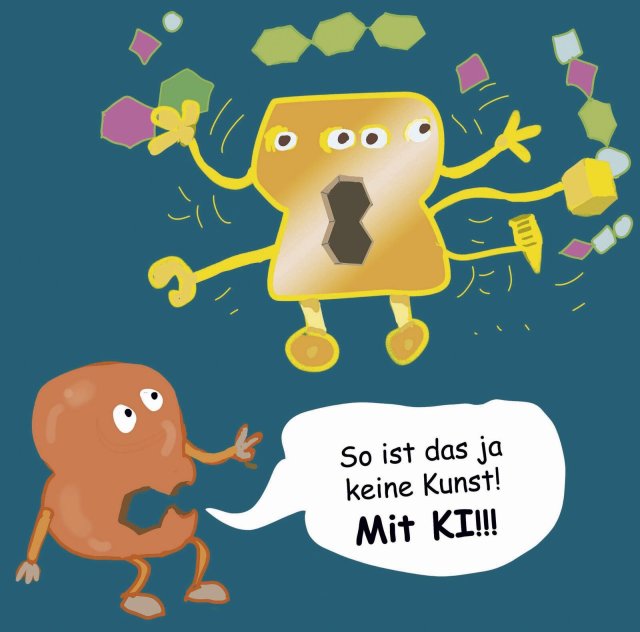
Vor sechs Jahren kämpften sich Biotechnologen und Chemiker durch die Abfälle einer Plastikflaschen-Recyclinganlage. Ihre Suche galt Mikroben, die PET (Polyethylenterephthalat) direkt abbauen können. PET ist vom Star der Plastik- und Textilindustrie zum Ärgernis in der Umwelt mutiert: Immerhin 12 Prozent des globalen festen Abfalls besteht aus diesem Kunststoff!
Polyethylenterephthalat ist eine Erfindung der beiden Engländer John Rex Whinfield und James Tennant Dickson. Ihnen gelang 1941 erstmals die Herstellung eines Polyesters aus Ethylenglycol und Terephthalsäure. Eine neue Kunstfaser war geboren. Da der Arbeitgeber der Erfinder – ein Unternehmen für Textildruck – mit der weiteren Entwicklung überfordert war, sorgte die britische Regierung dafür, dass das Chemieunternehmen ICI die Herstellungsrechte bekam. Der US-Konzern Du Pont, der schon an einem ähnlichen Material gearbeitet hatte, erwarb die Rechte für die USA und begann 1949 mit der Versuchsproduktion von Fasern und 1951 von Folien, die später nicht nur für Verpackungen dienten, sondern auch als Trägermaterial sehr reißfester Fotofilme und Tonbänder.
Die in der alten Bundesrepublik unter dem Namen Trevira und in der DDR als Grisuten hergestellten Polyesterfasern boomten seit den 1970er Jahren. Polyethylenterephthalat hat im Textilbereich die meisten anderen Synthesefasern weit überholt. Der Schwerpunkt der Herstellung allerdings hat sich, wie bei vielen anderen nicht nur chemischen Massenprodukten, von den USA und Europa gen Asien verschoben. Seit den 2020er Jahren ist China der größte Hersteller von Polyesterfasern. Vielen Konsumenten ist das Material unter der Abkürzung PET allerdings eher aus dem Getränkemarkt vertraut. Sind doch die Plastikflaschen dort – seien sie Mehrweg oder Zwangspfand – aus PET.
Polyethylenterephthalat ist allerdings wie andere Kunststoffe extrem langlebig. Selbst in der Tiefsee finden sich weitgehend unzerstörte PET-Flaschen. Ließe sich PET einfach in die zwei Ausgangsstoffe Terephthalsäure und Ethylenglycol zerlegen, würde das das Recycling erleichtern. Deswegen die eingangs erwähnte Suche im Abfall. Dabei fand man 2016 tatsächlich Bakterien, die PET direkt abbauen können. Nun hat ein Forscherteam um Hal Alpern von der Universität Texas in Austin einen weiteren wissenschaftlichen Durchbruch geschafft – Künstliche Intelligenz macht’s möglich! Ein sogenanntes neuronales Netzwerk mit einem selbstlernenden Algorithmus sagt Strukturänderungen an dem PET-Abbau-Enzym aus den Bakterien voraus. Trainiert wurde das Programm an 19 000 Proteinen mit ähnlichem Molekulargewicht wie die mikrobielle PETase. Dann die Suche: Jeder der 290 Aminosäure-Bausteine der PETase wurde virtuell durch 20 verfügbare Aminosäuren ausgetauscht. Dann sagte das Programm die Stabilität und Aktivität der Varianten voraus. Von mehreren Millionen möglicher Kombinationen fand das System drei Aminosäuren als Ersatz perfekt. Im Labor hätte man für diese Variantensynthese und Erprobung Jahre gebraucht.
Das neue Enzym FAST-PETase ist doppelt so schnell wie die beste bisher gefundene mikrobielle PETase und baut sehr verlässlich und schnell ganze PET-Flaschen und PET-Container direkt ab. Traum oder Albtraum? Müssen wir nun plastikfressende Bakterien befürchten?
Mitnichten! Das Enzym PETase kann sich ja nicht vermehren wie es Mikroorganismen tun würden.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.







