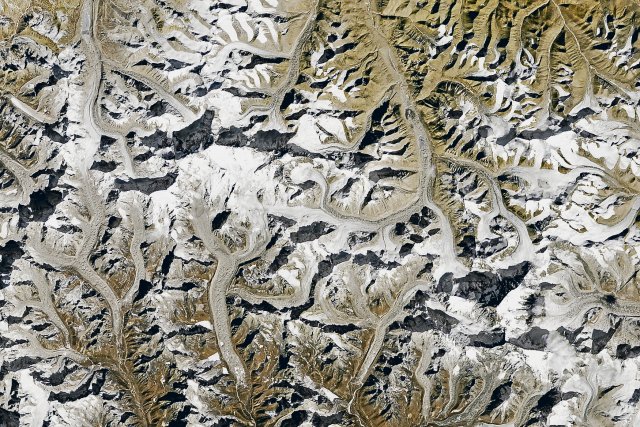- Wissen
- Bewegungspolitik
Philosophie oder Aktivismus?
Auf einer Tagung in Potsdam wurde das Verhältnis der Sozialphilosophie zu politischem Aktivismus diskutiert. Die gut gemeinte Rückendeckung für die Bewegung hat aber einen Haken
Spätestens seit Marx’ Diktum, dass die Philosophie die Welt nicht nur verschieden zu interpretieren, sondern zu verändern habe, steht das Verhältnis zwischen Philosophie und sozialer Bewegung zur Disposition. Entsprechend kompliziert ist diese Beziehung; sie war Gegenstand der Podiumsdiskussion zu Philosophie und Aktivismus, welche den Abschluss der Tagung »Social Movements, Epistemic Injustice, and Recognition Theory« bildete, die vom 4. bis 6. Mai 2023 an der Universität Potsdam stattfand.
Zur Diskussion eingeladen waren die Sozialphilosophen Daniel Loick und Robin Celikates, die US-amerikanische Politische Theoretikerin Candice Delmas, die zu Protestformen und zivilem Ungehorsam forscht, sowie Philosoph*in Nathan Rochelle DuFord. Alle Teilnehmenden verstehen sich als engagierte Philosoph*innen beziehungsweise Sozialwissenschaftler*innen, die – wie Daniel Loick gleich zu Beginn und ohne Widerspruch festhielt – keinen Unterschied zwischen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit und ihrem politischen Aktivismus machen.
Kein kategorialer Unterschied
Die Arbeit des aktivistischen Philosophen dürfe man sich nun aber nicht so vorstellen, dass die Philosophie dem Proletariat – von dem übrigens ansonsten nicht die Rede war – die geistigen Waffen an die Hand gibt und sich also die Emanzipation quasi von selbst einstelle, »sobald der Blitz des Gedankens gründlich in diesen naiven Volksboden eingeschlagen ist«, wie es der junge Marx einst formulierte. Ausdrücklich grenzte man sich auf dem Podium gegenüber Positionen ab, die ein objektiv wahres Wissen »von außen« an soziale Bewegungen herantragen wollen, um diese in die »richtige« Richtung zu lenken. Vielmehr gehe es der Philosophie um die Selbstaufklärung der Konflikte und Kämpfe in der Gegenwart, wie dann gleichwohl mit Marx-Bezug festgehalten wurde.
Im Rahmen der poststrukturalistischen Annahme, dass wissenschaftliche Objektivität eine Unmöglichkeit darstellt und lediglich eine Herrschaftserzählung neben anderen sei, ist dieser Anspruch nur konsequent. Damit allerdings würde sich die Aufgabe der Philosophie auf das Geschäft positivistischer Sozialwissenschaften beschränken, philosophische Reflexion wäre gleichbedeutend mit der begrifflichen Rekonstruktion dessen, was ohnehin ist. Jegliches Urteil über den geistig reproduzierten Gegenstand von Seiten der Philosophin oder des Philosophen wäre überflüssig, ja übergriffig – denn schließlich ist diese wissenschaftliche Beschreibung als Grundlage eines Urteils ebenso gut wie jede andere. Die Schlussfolgerung, sich eines normativen Urteils zu enthalten, zog übrigens auch Georg Vobruba in seinem 2019 erschienen Buch »Die Kritik der Leute«, wo er anmahnt, dass die eigene gesellschaftskritische Position und der eigene intellektuelle Anspruch auf Gesellschaftsgestaltung nicht den soziologischen Blick auf die Kritik der Leute verstellen dürfe.
Nun liegt den aktivistischen Philosoph*innen nichts ferner als eine normative Enthaltsamkeit, die sich neutral gegenüber dem Forschungsobjekt wähnt. Im Gegensatz zu Soziologen wie Georg Vobruba, der die eingeforderte Distanz zwischen Forschung und Gegenstand und also auch die Differenz zwischen Denken und Praxis durch wissenschaftliche Methodik aufrecht zu erhalten versucht, schlugen die Teilnehmer*innen den entgegengesetzten Weg ein. Es gehe nicht nur darum, eine – wie auch immer verstandene – Lücke zwischen Philosophie und politischem Engagement zu überbrücken, sondern vielmehr um die Einsicht, dass zwischen beiden überhaupt kein kategorialer Unterschied besteht.
Die angestrebte Identität von Theorie und Praxis tendiert jedoch zu dem Effekt, dass die Theorie zur nachträglichen Legitimation widerständiger Praxis gerät, deren Notwendigkeit und Rechtfertigung sich aus der diskriminierten und marginalisierten Stellung der Unterdrückten ergibt. Ein nachvollziehbarer Impuls, der jedoch nicht die Schwächsten zu ihrem Recht kommen lässt, sondern den Betroffenen auch noch die Verantwortung zuschiebt, jene Verhältnisse richtig zu begreifen, vor deren Erkenntnis die aktivistischen Philosoph*innen bereits kapituliert haben.
Kann man die Bewegung kritisieren?
Wer einer politischen Bewegung diese Aufgabe zuschiebt, kann ihr dann schwer widersprechen – was im Dienste jener Selbstaufklärung der Praxis aber zumindest möglich sein muss. In welche Situation sich eine Theorie manövriert, die sich als intellektuelles Spielbein einer progressiven Praxis versteht, kann in Georg Lukacs’ »Geschichte und Klassenbewusstsein« nachvollzogen werden, das dieses Jahr sein einhundertjähriges Jubiläum feiert. Zeitlebens haderte Lukacs nämlich damit, die historisch und politisch gebotene Entwicklung in Einklang mit seinen Überlegungen zu bringen, die bisweilen andere Schlussfolgerungen nahelegten.
Die sozialbewegten Philosoph*innen können dem Anspruch nach aber kaum zu einem anderen Ergebnis kommen als die Aktivist*innen, wenn sie den Kontakt zur Bewegung nicht verlieren wollen. Zwischen die normativen Aussagen der Philosophieaktivist*innen und die politischen Forderungen der Akteur*innen der sozialen Bewegung passt kein Blatt. Entsprechend verfügen die sozialkritische Philosophie und die ihr nahestehenden Sozialwissenschaften auch längst über Begriffe und Analysekategorien größtmöglicher Abstraktion, unter die alles und nichts zu fassen ist. So werden etwa die spezifischen Formen institutionalisierter Herrschaft als »komplexe Machtverhältnisse« identifiziert, die »lokal« – »an besonderen und scharfen Punkten«, so DuFord – bekämpft und »transformiert« werden müssen.
Nun trifft der Umstand, dass die zugrundeliegenden Rahmentheorien die Bandbreite möglicher Forschungsergebnisse festlegen, auf jede Wissenschaft zu. Entsprechend gehört die offene Auseinandersetzung über Vor- und Nachteile dieser oder jener Forschungsansätze, sozialtheoretischer Grundbegriffe und Paradigmen zur Wissenschaftlichkeit dazu. Dieser Aspekt aber wird in der Einheit von wissenschaftlicher Arbeit und aktivistischem Bezug tendenziell hinfällig. Auch Wissenschaftler*innen agieren zunehmend in ihrer eigenen Blase, die Gegenpositionen nur mehr als Karikatur und als Provokation der eigenen Überzeugung durchlässt – sofern man sich mit ihnen überhaupt auseinandersetzt. Die Nähe zur politischen Bewegung, also der »Praxisbezug«, wird selbst zum Gütekriterium der Theorie.
Darin besteht der Unterschied zu vergangenen Debatten über das Verhältnis von Wissenschaft und sozialer Bewegung. In den 1980er Jahren etwa wurde bereits über zivilen Ungehorsam diskutiert und Kritik geübt an den Koryphäen einer sozialwissenschaftlichen Protest- und Bewegungsforschung aufgrund der politischen Nähe zum Forschungsgegenstand (unter anderem traf dies Dieter Rucht, Karl-Werner Brand und Roland Roth). Auch in jenen Auseinandersetzungen wurde mit harten Bandagen gekämpft und schon damals schenkten sich die Kontrahenten nichts. Aber im Unterschied zu heute gab es noch eine Debatte zwischen Vertretern gegensätzlicher Positionen, die im besten Fall am Problem arbeitete und nicht nur deren feststehende Positionierung bestärkte.
Formale Offenheit als Vorteil
Nun kann und sollte man eine derart grundsätzliche Auseinandersetzung nicht von einer Veranstaltung erwarten, die von vorneherein eher als ein Austausch unter Gleichgesinnten denn als Streit von Andersdenkenden angelegt war. Entsprechend harmonisch ging es auf dem Podium zu. Positionen, wie sie seinerzeit Luhmann oder Habermas vertraten und gegenwärtig der Historiker Philipp Gassert, suchte man vergebens: nämlich, dass Proteste und soziale Bewegungen gar keine »Problemlösungskompetenz« haben, sondern eher einen Indikator für gesellschaftliche Defizite und Fehlentwicklungen darstellen und damit auch eine systemkonforme Bearbeitung durch die parteipolitische Öffentlichkeit ermöglichen.
Es herrschte unter den Referent*innen nicht nur Konsens darüber, dass soziale Bewegungen notwendige gesellschaftliche Transformationen vorantreiben, sondern auch darüber, selbst Teil der richtigen – weil progressiven – Bewegung zu sein. Diese würden sich von regressiven Bewegungen dadurch unterscheiden, dass letztere die internen Differenzen (hierarchisch) zugunsten eines gemeinsamen Ziels unterdrückten, während linke, progressive Bewegungen Diskussion, Konflikt und Pluralität als Werte an sich betrachteten. Der damit verbundene strategische Nachteil etwa gegenüber dem Rechtspopulismus, so Celikates, müsse als ein demokratischer Vorteil verstanden werden. Und DuFord wollte gar die Auseinandersetzungen innerhalb der Bewegung als ebenso wichtig verstanden wissen wie den Kampf mit dem politischen Gegner. Wie aus dem »demokratischen Vorteil« allerdings auch politisch Kapital geschlagen werden könnte, blieb offen. Linkspopulistischen Projekten jedenfalls, die die Austragung interner Differenzen zugunsten gemeinsamer Aktionen auf später verschieben wollen, erteilte man eine Absage.
Dass die Demarkationslinie zwischen guten und schlechten, progressiven und regressiven Bewegungen auf rein formale Aspekte reduziert wurde, schien die Diskutant*innen dabei nicht zu stören. So trat an die Stelle inhaltlicher Bestimmungen ein leerer Formalismus. Das ist kein Zufall, sondern Grundannahme der postmarxistischen beziehungsweise poststrukturalistischen Theoriebildung. Inhaltliche Aussagen über Richtung und Güte sozialer Bewegungen gelten dort als essenzialistische, eurozentristische und damit unberechtigte Festlegungen. Entsprechend wurden Pluralismus, Streitbarkeit, Anschluss- beziehungsweise Koalitionsfähigkeit, Flexibilität, Transparenz, Experimentalismus und so weiter zu Merkmalen progressiver Bewegungen erhoben – im Übrigen alles Eigenschaften, wie sie auch in jedem x-beliebigen Managementratgeber angepriesen werden.
Auf die sich hier notwendig ergebene Frage, worauf sich die Gemeinsamkeit der jeweiligen partikularen Kämpfe und Konflikte nun begründet – denn darüber, dass sie alle miteinander zusammenhängen, war man sich einig –, konnte keine Antwort gegeben werden. Mögliche Kandidaten für eine Antwort, etwa Nationalstaatlichkeit oder Kapitalismus, würden ja bereits zu starke Rahmenentscheidungen und Festlegungen der Bewegung bedeuten. Schließlich stand die unbeantwortete Frage im Raum, ob diese Vorstellung aktivistischer Philosophie nicht auf einen leeren Aktivismus hinauslaufe. In welche Sackgasse sich die Diskussion konkret bewegte, offenbarte ein von Moderator Jacob Blumenfeld in die Diskussion eingebrachtes Zitat von Adorno, der auf die Behauptung Herbert Marcuses, die Theorie-Debatte würde bisweilen durch die Praxis vorangetrieben, antwortete: Die Praxis allein lasse noch keine Fortschritte erwarten.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.