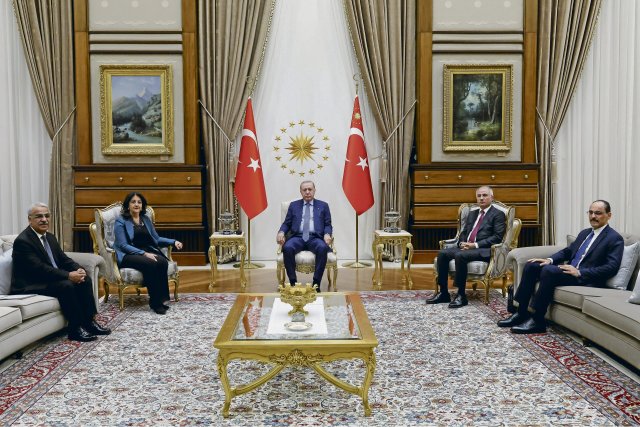- Politik
- US-Präsidentschaftswahlen
Donald Trump: Schwedische Gardinen oder Weißes Haus?
Donald Trump steht erneut vor Gericht, und auf den ersten Blick hat Joe Biden damit gute Chancen auf eine Wiederwahl. Doch der Ex-Präsident könnte ihm sehr gefährlich werden – und die Geopolitik weiter destabilisieren

Es sind bemerkenswerte Szenen, die sich am Donnerstag vor dem Bundesbezirksgericht in Washington D.C. abspielten: Ein ehemaliger Präsident der USA plädierte dort in einem Strafverfahren, in dem ihm versuchter Wahlbetrug und die Behinderung von Amtsgeschäften vorgeworfen wird, auf »Nicht schuldig«. Es ist nicht das erste Mal, dass Trump in diesem Jahr vor den Richter treten muss. Allein aufgrund der Anklagepunkte im jüngsten Fall könnte er zu einer Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt werden. Doch wie so viele Skandale zuvor scheint Donald Trump auch seine jüngste Auseinandersetzung mit der US-Justiz politisch nicht signifikant zu schaden. Die Chancen dafür, dass Trump Anfang 2025 wieder ins Weiße Haus einzieht, sind alles andere als gering. Eine Rückkehr dorthin stellt für ihn vermutlich auch aus juristischer Sicht eine riskante, aber vielversprechende Verteidigungsstrategie dar.
Wenn man nichts als die reinen Zahlen betrachtet, steht Amtsinhaber Joe Biden momentan eigentlich gut da: Die USA vermelden stabile Wirtschaftszahlen und einen weiterhin soliden Arbeitsmarkt, während sich die Inflation langsam abschwächt und auf etwa drei Prozent gefallen ist. Die Umfragewerte des amtierenden Präsidenten sind seit einigen Wochen leicht im Aufwind, die Zustimmung zu seiner Regierungsführung ist wieder auf über 40 Prozent gestiegen. Über Monate lag er Kopf an Kopf mit seinem Amtsvorgänger Trump, in den jüngsten Erhebungen hat sich Biden einen leichten Vorsprung von etwa zwei Prozent erkämpft.
Noch ist der Ausgang der Wahl im November nächsten Jahres völlig offen. Doch einige US-Demokraten wie der Politberater Simon Rosenberg sehen bereits Anlass für Optimismus. Die Ausgangslage sei für die Demokraten günstig, die Medien der Partei gegenüber zu negativ eingestellt, was die wahre Schwäche der Republikaner verberge. »Ich wäre viel lieber wir als sie«, erklärt Rosenberg selbstsicher in seiner Analyse der Wahlen der letzten Monate, bei denen die Demokraten unter anderem den Bürgermeisterposten in Jacksonville, Florida, zurückeroberten. Dennoch spricht einiges dafür, dass die Hoffnungen auf einen Wahlsieg verfrüht sein könnten. Bidens Vorgänger darf sich mindestens genauso hohe Chancen ausrechnen.

Teller und Rand ist der nd.Podcast zu internationaler Politik. Andreas Krämer und Rob Wessel servieren jeden Monat aktuelle politische Ereignisse aus der ganzen Welt und tischen dabei auf, was sich abseits der medialen Aufmerksamkeit abspielt. Links, kritisch, antikolonialistisch.
Donald Trump, der sich bereits wegen Sexualdelikten, Unterschlagung von Geheimdokumenten sowie Verstößen gegen Wahlkampffinanzierungsregeln vor verschiedenen Gerichten verantworten muss, sieht sich nun also auch mit einer Anklage wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 und dem Versuch, den Ausgang einer demokratischen Wahl zu missachten, konfrontiert. Doch, wie er selbst bereits im Wahlkampf von 2016 auf seine sehr eigene Weise ausdrückte: Die republikanische Basis verzeiht ihm alles. »Ich könnte jemanden mitten auf der Fifth Avenue erschießen und ich würde keine Stimmen verlieren«, kommentierte Trump den Vorwahlkampf damals, und an dieser im Grunde zutreffenden Einschätzung hat sich bis heute nichts geändert. Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters betrachten drei Viertel der Republikaner*innen die Verfahren gegen Trump als politisch motiviert.
Etwa vierzig Prozent Vorsprung genießt Trump in den Umfragen zu seinem nächsten Herausforderer, Ron DeSantis, dem Gouverneur von Florida. Dieser produziert am laufenden Band schlechte Presse für sich selbst, von Kampagnenvideos mit Nazi-Symbolik bis zu Gerüchten über seine schlechten Tischmanieren. DeSantis richtet mit seiner Politik in Florida viel Schaden an, die rassistische und revanchistische Geschichtsschreibung der Südstaaten wird an Schulen unterrichtet, sexuelle Minderheiten verfolgt und unsichtbar gemacht. Man darf ihn auf keinen Fall verharmlosen. Doch dass er zum Präsident taugt, glauben in und außerhalb der Partei immer weniger US-Amerikaner*innen.
Ungebrochener Personenkult
Selbst aus dem Gefängnis oder der Untersuchungshaft würden die Republikaner Trump wohl ins Rennen schicken. Er könnte bei einem Wahlsieg anschließend versuchen, sich selbst zu begnadigen, oder die Strafe müsste suspendiert werden, damit er sein Amt wahrnehmen könnte. Aus juristischer Sicht spricht nichts gegen eine Kandidatur Trumps, selbst als zu diesem Zeitpunkt möglicherweise verurteilter Straftäter. Wenig hilfreich ist, dass sich um Hunter Biden, Sohn des Präsidenten, ebenfalls eine Reihe von Skandalen rankt: Er gab offensichtlich beträchtliche Summen für Drogen aus und bezahlte für Sex. Nun steht er wegen Steuerhinterziehung vor Gericht.
Joe Biden hat bei den Demokraten trotzdem einen ähnlich großen Vorsprung vor seinen Herausforderern. Sein parteiinterner Rückhalt ist vergleichbar mit dem von Trump. Der Impfgegner und Verschwörungstheoretiker Robert F. Kennedy junior richtet sich mit seiner Botschaft eher an Republikaner, politisch Ungebundene und Unzufriedene. Sein Plan könnte sein, letztlich als republikanischer Vizepräsidentschaftskandidat, vermutlich neben Trump zu werden. Kennedy könnte als »vernünftiger« Vertreter der politischen Gegenseite im Rahmen einer Kandidatur der »nationalen Einheit« antreten. Doch dies wäre eine reine republikanische Propagandaoperation, von den Ansichten der demokratischen Basis ist er meilenweit entfernt.
Marianne Williamson, Bidens andere bekannte Gegenkandidatin, könnte ein gewisses Grundpotenzial an linken Wähler*innen eher ausschöpfen. Doch auch die Autorin spiritueller Selbsthilfebücher hat es schwer, die breite Parteibasis zu erreichen. Diese steht, wenn auch nicht unbedingt begeistert, fest zu ihrem Präsidenten. Biden ist alt und unbeliebt, hat Trump aber schon einmal geschlagen. Er könnte es wieder schaffen, so das einfache Kalkül vieler Demokraten.
Zum jetzigen Zeitpunkt deutet also viel darauf hin, dass 2024 Biden und Trump wieder gegeneinander antreten, die US-Präsidentschaft also wieder zwischen zwei dann sehr betagten weißen Männern entschieden wird. Eigentlich ist dieses Szenario fast gesichert, es sei denn, der Gesundheitszustand eines der Kandidaten lässt dies nicht zu.
Zum Nachteil Bidens wirken eine Reihe von Faktoren. Landesweit gewann der Demokrat die Wahl von 2020 mit einem Vorsprung von mehreren Millionen Stimmen. Doch aufgrund des US-amerikanischen Wahlsystems, in dem eine Versammlung von den Bundesstaaten entsandter Wahlleute über den Präsidenten bestimmt, entschieden letztlich wenige zehntausend Stimmen in den Bundesstaaten Wisconsin, Georgia und Arizona über den Ausgang der Wahl. Trump genießt also einen strukturellen Vorteil: Biden braucht national betrachtet einen Vorsprung von etwa drei Prozentpunkten, bei Stimmengleichheit würden die entscheidenden Bundesstaaten wohl an Trump fallen. Diesen Sicherheitsabstand in den Umfragen konnte sich der Präsident bisher nicht erkämpfen.
Konkurrenz für Biden
Selbst wenn Biden es schafft, Trump hinreichend kleinzuhalten, könnten ihm eine Reihe anderer Kandidaturen am Ende die nötigen Stimmen in den entscheidenden Staaten kosten. Der Kandidat der grünen Partei, der Philosoph Cornel West, erreichte in manchen Umfragen bis zu sechs Prozent der Stimmen. West ist eine Ikone der US-amerikanischen Linken und selbst bei ideologischen Gegnern persönlich hoch angesehen. Wegen seiner Kandidatur wurde er aus dem Lager der Demokraten trotzdem bereits heftig attackiert. Die Kritik, er könnte Biden den Wahlsieg kosten, ist nicht ganz unberechtigt: Selbst wenn er überwiegend Nichtwähler*innen und Menschen, für die die Demokraten unter keinen Umständen mehr infrage kommen, mobilisiert, könnte er dem Präsidenten die wenigen entscheidenden Stimmen abspenstig machen. Noch ist unklar, ob West in allen Bundesstaaten antritt, es ist aber davon auszugehen, dass er es in der Mehrzahl auf den Wahlzettel schafft.
Wesentlich undurchsichtiger als die Kampagne von West ist die Initiative No Labels. Das politische Projekt, das offiziell als Verein und nicht als politische Partei registriert ist und seine Geldgeber*innen deshalb nicht offenlegen muss, versammelt unzufriedene Zentrist*innen aus beiden großen Parteien, um eine mögliche unabhängige Kandidatur neben Trump und Biden zu unterstützen. Noch, so betont man dort, habe man sich nicht entschieden, diesen Schritt zu gehen. Doch die Unbeliebtheit der Spitzenkandidaten der etablierten Parteien macht manchem Hoffnung, eine dritte Partei könnte im kommenden Jahr erfolgreich sein. Auf einen potenziellen Kandidaten will man sich ebenso wenig festlegen wie auf eine Teilnahme an der Wahl, man prüfe die Optionen, wie Vertreter*innen der Initiative gegenüber dem Radiosender NPR erklärten.
Ein Name fällt im Zusammenhang mit No Labels allerdings immer wieder: Joe Manchin, der konservative demokratische Senator aus West Virginia, der das Klimapaket von Biden erst beerdigte und dann mithalf, es in Form des Inflation Reduction Act wiederzubeleben. Manchin selbst hält sich ebenfalls bedeckt, will eine Kandidatur aber nicht ausschließen. Laut Rosenberg könnte Manchin aber nur mit etwa zwei Prozent der Stimmen rechnen, die Mehrheit davon käme wohl aus dem republikanischen Lager. Wie gefährlich er oder ein anderer zentristischer Kandidat Biden tatsächlich werden könnte, ist noch unklar.
Mit der Feststellung, dass die wichtigsten Kontrahenten bei der Wählerschaft unbeliebt sind, mag No Labels recht haben. Weniger als an einer inhärenten Präferenz vieler Wähler*innen für zentristische Politik dürfte dies aber daran liegen, dass beide Kandidaten Skandale umgeben, die für Zynismus und Resignation sorgen, da weder Demokraten noch Republikaner die wirklichen materiellen Alltagssorgen der großen Mehrheit adressieren können. Die allermeisten US-Wähler*innen beschäftigen sich nur am Rande mit der Politik. 2024 dürften viele ihre Entscheidung schlicht auf der Grundlage treffen, ob das Leben gefühlt unter Trump oder unter Biden einfacher war.
In den Händen der Fed
Die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt fielen – Pandemieeffekte einmal beiseite – unter beiden Präsidenten für Beschäftigte günstig aus. Unter Biden hat allerdings die Inflation deutlich angezogen. 2024 wird viel davon abhängen, wie sich die wirtschaftliche Lage bis dahin entwickelt. Klingt die Inflation weiter ab, ohne dass die Arbeitslosigkeit merklich ansteigt – was derzeit der Fall zu sein scheint – hat Biden bessere Karten. Gelingt die geldpolitische »sanfte Landung« der Federal Reserve nicht, wird es brenzlig für den Präsidenten.
Mit einem Konjunkturabschwung stünde der Welt wohl eine zweite Amtszeit für Donald Trump bevor – und diese wäre mit zahlreichen Unwägbarkeiten behaftet. Innenpolitisch wird viel davon abhängen, ob Trump eine deutliche Mehrheit im Kongress hinter sich haben würde: In letzter Zeit spricht eher weniger dafür. Bei der letzten Wahl zum Repräsentantenhaus verloren die Demokraten überraschend wenige Sitze, obwohl sie landesweit im Rückstand waren, ein struktureller Nachteil scheint für die Partei hier nicht mehr zu bestehen. Eine Reihe von Gerichtsurteilen hat der Partei in den Südstaaten sowie in New York einen günstigeren Zuschnitt der Wahlkreise beschert, und Wisconsin, dessen oberstes Gericht wieder von Liberalen kontrolliert wird, könnte bald folgen.
Im Senat haben die Republikaner zwar gute Aussichten, demokratische Senatoren aus drei Bundesstaaten abzulösen, doch selbst dies würde ihnen nur eine knappe Mehrheit in der Kammer verschaffen. Die Institutionen des US-amerikanischen Staates und die Zivilgesellschaft wären außerdem auf eine zweite Trump-Präsidentschaft besser vorbereitet, da seine autoritären Ambitionen nun allgemein bekannt sind und Warnungen davor nicht mehr als Panikmache abgetan werden können. Eine realistische Chance, sie umzusetzen, hätte Trump wohl nur nach einem Erdrutschsieg der Republikaner. Doch ein solcher ist bislang nicht in Sicht. Dass er einfach durchregieren können wird, ist gegenwärtig unwahrscheinlich. Bidens Errungenschaften, wie etwa in der Klimapolitik, wären auch nach einer Rückkehr von Trump ins Weiße Haus wohl nicht unmittelbar gefährdet, die USA würden nicht unvermeidlich in den Autoritarismus abgleiten.
Kein Friedensstifter
Mit größeren Unsicherheiten ist die Außenpolitik behaftet, da der Präsident hier mit wesentlich mehr vom Kongress unabhängigen Befugnissen ausgestattet ist. Geopolitische Spannungen haben unter den letzten vier US-Präsidenten merklich zugenommen, und Trump war in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Zwar signalisiert Trump, dass er den Konflikt in der Ukraine gerne durch einen »Deal« mit Putin beenden würde – doch auch unter seiner Präsidentschaft verschlechterte sich das russisch-amerikanische Verhältnis weiter. Weder Trump noch Biden fanden Mittel, Putin zu konstruktiver Zusammenarbeit zu bewegen.
Es mag verlockend sein, Trumps Außenpolitik zu psychologisieren und ihm eine besondere Affinität für autoritäre Herrscher wie Putin und Mohammed bin Salman zuzuschreiben – belegen lassen sich solche externen Zuschreibungen nicht. Und allen wilden Gerüchten über Kompromat, mit dem Moskau Trump angeblich unter Druck setzte, zum Trotz erzielte Trump mit Putin keine umfassende Einigung, mit der sich das Verhältnis zwischen den USA und Russland dauerhaft entspannt hätte. Wahrscheinlich führt die Annahme, Trumps Außenpolitik sei primär ideologisch motiviert, ohnehin eher in die Irre. »Insofern der Ex-Präsident überhaupt eine eigene Weltanschauung hat, so handelt es sich dabei um eine wilde Mischung aus Nationalismus und Pseudo-Merkantilismus«, analysiert Daniel DePetris im konservativen »Spectator« zutreffend. Trump hatte zu geopolitischen Rivalen wie zu Alliierten ein gleichermaßen transaktionales Verhältnis, das außer dem Eigennutz wenig Prinzipien kannte. Wer den Handelsstreit zwischen der EU und Biden über die US-Klimasubventionen verfolgt, stellt fest, dass ein gewisser Anteil dieses Denkens im US-Regierungsapparat überdauert zu haben scheint. Amerika gestaltet seine Handelsbeziehungen nun ganz offen zum eigenen Vorteil, ohne sich mit dem ideologischen Beiwerk des angeblich »freien Handels« zu schmücken. Deglobalisierung und eine neue Blockkonfrontation gilt in Washington inzwischen als unvermeidlich, man möchte sie lediglich zum eigenen Vorteil ausgestalten und gewinnen.
Es wäre deshalb gefährlich, Trumps Aussagen zum Ukraine-Krieg als Ausdruck eines grundsätzlichen Bruchs mit dem Prinzip der amerikanischen Vorherrschaft in der Welt zu deuten. Trumps politische Instinkte verraten ihm, dass er militärische Eskalationen scheuen sollte. In der Handelspolitik würde er seinen konfrontativen Kurs gegenüber China aber wohl fortsetzen. Doch friedliche internationale Beziehungen sind in einer Welt der permanenten wirtschaftlichen Auseinandersetzungen schwer vorstellbar. Parteiübergreifend fehlt den USA das Konzept einer aktiven Friedenspolitik – genau wie eine sichtbare Friedensbewegung auf der Straße. Eine Rückkehr von Trump ins Weiße Haus würde daran nichts ändern.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.