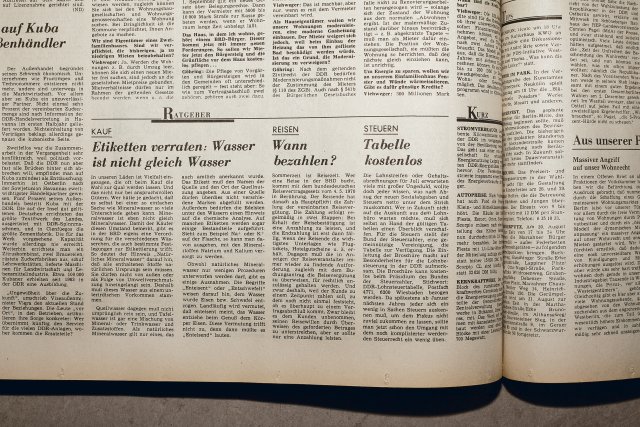Zivilprozessordnung: Wer hat Anspruch auf Unterstützung bei Gerichts- und Anwaltskosten?
Rechtshilfe
Ob zwischen Nachbarn, Mietern und Vermietern oder Handwerkern und Auftraggebern – Konflikte können überall und immer auftreten. Und häufig landen Streitigkeiten, die auf den ersten Blick harmlos erscheinen, vor Gericht. Ein Prozess kann rasch teuer werden und das finanzielle Risiko ist oft schwer einzuschätzen. »Das Prozessrisiko beinhaltet sowohl die Kosten für den eigenen und den gegnerischen Anwalt als auch die Gerichtsgebühren«, so die Juristin Anne Kronzucker.
Bei geringem Einkommen und Vermögen und guten Erfolgsaussichten im Prozess besteht die Möglichkeit, Prozesskostenhilfe vom Staat zu beantragen. Wird der Prozess verloren, werden bei dem durch Prozesskostenhilfe finanzierten Verfahren die Anwaltskosten der Gegenseite allerdings nicht getragen.
Damit Bürger mit geringen finanziellen Mitteln ihre Rechte gegebenenfalls auch vor Gericht wahrnehmen können, gewährt der Staat unter bestimmten Voraussetzungen bei Prozessen eine finanzielle Unterstützung. Sie umfasst die gesamte oder teilweise Übernahme der Gerichts- und der eigenen Anwaltskosten. Die prozessführende Partei muss allerdings, soweit zumutbar, ihr Vermögen einsetzen. Die Bedingungen, zu denen der Staat diese Hilfe gewährt, listen die Paragrafen 114 bis 127a der Zivilprozessordnung auf. Ausschlaggebend sind die wirtschaftlichen Verhältnisse. Wenn die Prozesskosten eine übermäßige persönliche finanzielle Belastung darstellen, zudem eine Aussicht auf Erfolg bei dem bevorstehenden Prozess besteht und der Prozess nicht mutwillig angestrebt wird, so hat ein Antrag auf Prozesskostenhilfe Aussicht auf Erfolg.
Für die Gewährung der Prozesskostenhilfe gilt eine Einkommensgrenze, die sich an dem so genannten »einzusetzenden Monatseinkommen« orientiert. Darunter ist das Einkommen nach Abzug aller Belastungen wie beispielsweise Steuern, Versicherungen und Miete sowie Kredite zu verstehen. Auch die Kosten für den eigenen Unterhalt und den anderer unterhaltsberechtigter Personen werden berücksichtigt.
Neben dem monatlichen Einkommen wird auch das freie Vermögen, beispielsweise ein Sparbuch, mit in die Bewertung der finanziellen Verhältnisse einbezogen. Dagegen wird das Eigenheim, solange es zu eigenen Wohnzwecken dient, nicht berücksichtigt.
Verändern sich die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse bis zu vier Jahre nach Prozessabschluss positiv, so kann das Gericht die Prozesskostenhilfe zurückfordern.
Beabsichtigen Sie, die staatliche Unterstützung zu beantragen, dann sollten Sie bereits beim ersten Gespräch mit dem Anwalt darauf hinweisen. Antragsunterlagen erhalten Sie beim Prozessgericht oder im Internet auf den Seiten des Bundesjustizministeriums. (www.bmj.bund.de)
Neben dem ausgefüllten Antragsformular müssen Sie umfassend über Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse Auskunft geben. Das Gericht entscheidet über eine, eventuell auch nur teilweise, Übernahme der Kosten.
Wichtig zu wissen: Während eine Rechtsschutzversicherung die gesamten Anwalts- und Gerichtskosten übernimmt, muss der Verlierer des durch Prozesskostenhilfe finanzierten Prozesses die Kosten des Gegners übernehmen! Eine Ausnahme sind Arbeitsrechtsprozesse, bei denen alle Beteiligten die eigenen Anwaltskosten zu zahlen haben.
Weitere Informationen unter www.das-rechtsportal.de
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.