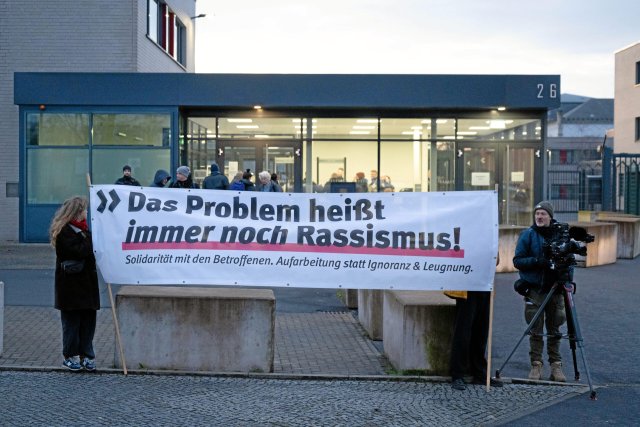- Politik
- Essay
Der Riss in der Zeit und der Riss in der Seele
Wie Hermann Hesse Emil Sinclair wurde
Aber schon im November 1914 erscheint in der »Neuen Zürcher Zeitung« der Aufruf »O Freunde, nicht diese Töne«. Denn Hesse ist schockiert über diesen Ausbruch von Hass. Er, der sich immer als »Alemanne« fühlt, als Niemandslandbewohner zwischen der Schweiz und Deutschland, ist von dem überschäumenden Nationalismus zutiefst angewidert. Nach seinem Artikel, der zu Mäßigung und Menschlichkeit aufruft, wird er zum Nestbeschmutzer erklärt. So heißt es am 24.10.1915 im Kölner Tageblatt: »Schamröte muß geradezu jedem ehrlichen Deutschen ins Gesicht steigen, wenn er in dieser größten Not des Vaterlands, da ältere deutsche Dichter wie Dehmel, Bloehm, Löns mit der Waffe in der Hand für ihr Vaterland eintreten und ihr Blut freudig hingeben, hört, daß ein bis dahin gefeierter deutscher "Ritter des Geistes" sich noch brüstet mit seiner Drückebergerei und schlauen Feigheit und sich geradezu lustig macht darüber, wie es ihm gelungen ist, seinem Vaterlande und seinen Gesetzen in dieser großen Zeit ein Schnippchen zu schlagen.«
Hesse arbeitet in Bern für die deutsche Gefangenenfürsorge. Die ist zuerst der deutschen Gesandtschaft unterstellt, dann dem Kriegsministerium in Berlin. Hesse gilt nun als »Beamtenanwärter«, gibt die »Deutsche Interniertenzeitung« heraus, organisiert einen Buchversand in Gefangenenlager und träumt von seiner Wiedergeburt als neuer Mensch - nach dem Krieg. Er korrespondiert mit Romain Rolland. Dieser ihm so verwandte Geist soll sein Feind sein? Beide sind sich einig, was auf keinen Fall zur Kriegsbeute werden darf, ist das »Gewissen Europas«. Das fordert den von Politik und Ideologie unabhängigen Intellektuellen, mit seinem Vermögen zu Kritik und Vision gleichermaßen. Hesses Vorgesetzte im Kriegsministerium fordern ihn ultimativ auf, keine pazifistischen Artikel mehr zu veröffentlichen. Denn das grenzt in Kriegszeiten an Hochverrat. Also muss ein Pseudonym her. Er nennt sich nun Emil Sinclair, wie der Freund Hölderlins, und beginnt 1917 unter diesem Namen für Zeitungen zu schreiben. Der Dichter als Zeitkritiker spürt den Riss, der durch das Jahrhundert geht, in seiner Seele: »Ich bin zur Erkenntnis geschichtlich-politischer Wirklichkeit während des Ersten Weltkriegs erwacht und habe seither die Schlafmütze nie mehr benützt.«
Inzwischen häufen sich die privaten Katastrophen. Seine Ehe mit Maria Bernoulli wird geradezu unlebbar, 1916 schließlich stirbt der Vater. Und mit dem Vater die Väterwelt, gegen die er rebellierte. Er spürt: Er hat zu kurz gegriffen mit seinem bisherigen Leben und der Erfolg beim Publikum hat ihm die Augen davor verschlossen. Aber nun liegt sie offen, die Katastrophe. Um ihn herum in Europa - und tief in ihm. Seine Leser? Sie marschieren, töten und sterben in den Schützengräben. Hesse, der Schwärmer, der Idylliker, der sich so leicht begeistert; inmitten kollektiver Ekstasen und kollektiven Jammers bleibt er ganz kalt. Er steht allein und sieht die großen aufeinander prallenden Ideologien mit zunehmender Distanz.
All das gehört zur Vorgeschichte der Seelenbiografie »Demian - Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend« (1919). Darauf, so sieht er jetzt, ist es hinausgelaufen: auf Korrektur, die am Grunde des Ich ansetzt, in der Kindheit. Um neu anzufangen, muss Hesse zurück an den Anfang gehen: »Der Vogel kämpft sich aus dem Ei.« Der Vogel, das ist Hesse selber. Für seine dritte Frau Ninon Dolbin schreibt er später sein autobiografisches Märchen »Vogel«. »Der Strick ist zerrissen, der Vogel ist frei.« Dieses Bibel-Zitat aus dem »Demian« lässt Hesse in den Grabstein des Vaters meißeln, der die letzten Jahre seines Lebens in der Pietistengemeinde in Korntal verbrachte. Ein lebenslang Unzeitgemäßer auch er, das bemerkt Hesse nun und ist erschreckt. Ist er dem Vater, der den trotzigen Jungen einst in die Irrenanstalt nach Stetten bringen ließ, vielleicht ähnlicher als er inmitten der Rebellion dachte?
Bisher ist er immer fortgelaufen, wenn es schwer wurde. Als Fünfzehnjähriger aus der Stiftsschule Maulbronn, nach nur sieben Monaten. 1911, kurz nachdem sein dritter Sohn Martin geboren wurde, begibt er sich auf eine mehrmonatige Hinterindienreise. Das Aufeinandertreffen von romantischem Indien-Traum und schnöde-schmutziger Wirklichkeit aber wird zu einer weiteren Enttäuschung.
Im Frühjahr 1919 verlässt Hesse seine an Schizophrenie erkrankte Frau Maria Bernoulli, die gegen ihren Willen in einer psychiatrischen Anstalt interniert wird (welch schauderhafte Parallelen!), gibt die Söhne zu Freunden in Pflege und flieht - nach Süden, nach Süden! Als ein »kleiner abgebrannter Literat« kommt er in Montagnola auf der Südseite der Alpen am Luganer See an, durch Krieg und Wechselkurse fast ohne Einnahmen, nur mit einigen Bücherkisten. Der Künstler sollte gar nicht erst versuchen, ein Bürger zu sein, weiß er nun. Hesse lebt in Montagnola dreiundvierzig Jahre lang, bis zu seinem Tod am 9. August 1962. Hier erst lässt er alle Fluchten hinter sich. Nur von steppenwölfischen Wintern in Zürich (und dessen Nachtleben) und Badener Erholungs-Kuren unterbrochen, sieht Hesse sich nun als lebenslänglich Krisengefangenen, mit täglichem Gartenausgang.
»Demian« ist Psychoanalyse, ins Literaturhafte gewendet. Ein gefährliches Experiment für einen Dichter, wie Hesse sehr wohl weiß. Man muss seine Geheimnisse - auch vor sich selbst - hüten, die Krankheit, die die Kunst dem Künstler ist, pflegen. Die Nietzsche-Parallele liegt offen. Im »Zarathustra« lesen wir: »Nacht ist es: nun reden lauter alle springenden Brunnen. Und auch meine Seele ist ein springender Brunnen.« Hesse schließt im »Demian« wie bruchlos an des »Wanderers Nachlied« an: »Es war ein Stein in den Brunnen gefallen und der Brunnen war meine junge Seele.«
Dreierlei ist »Demian«. Erstens: Die Entdeckung der Kindheit des Autors wird zur Entdeckung der Kindheit in der Literatur. Hesse beschreibt hier die Innenseite der Drill-Schulgeschichte »Unterm Rad«. Kindheit als Leidensgeschichte: »Ich habe nur selten in meinem Leben so tief erlebt und gelitten wie damals.« Zweitens: Es wird ein Buch über das Mysterium der menschlichen Seele. Wir wissen nicht, was der Mensch ist, aber wir müssen es herausfinden wollen. Harmonie herstellen? Hesse unterscheidet von allen Esoterikern, dass er um den Kontrapunkt in jeder Harmonie weiß. Erst der - integrierte - Missklang bildet den Wohlklang. Drittens: Hesse liefert im »Demian« eine Zeitkritik, die, gerade im Verzicht auf jede Vordergründigkeit, an die Fundamente geht. Der erschreckende Befund: Dem 20. Jahrhundert sind die Fundamente gänzlich abhanden gekommen.
Der Wille zur Erziehung trifft auf die Einsicht in die Unmöglichkeit aller Erziehung. Das Goethische Selbstvervollkommnungsideal ist seinem Wesen nach autodidaktisch, getragen von einem vehementen Misstrauen in alle Bildungsinstitutionen. Den akademischen Bescheidwissern begegnet Hesse jetzt im ekstatischen Sommer 1919 mit einer an offenen Hohn grenzenden Ironie. »Klingsors letzter Sommer« ist von einer beinahe manischenÜbermütigkeit, auf die im darauf folgenden Jahr der depressive Rückschlag folgt. Das angefangene Manuskript des »Siddhartha« bleibt über ein Jahr unberührt, der Dichter liegt, vor Kälte trotz Sommerhitze zitternd mit Depressionen im Bett. Jetzt fliegt auch das Pseudonym Emil Sinclair auf. Denn diesem Sinclair wird der Fontane-Preis für Nachwuchsautoren zugesprochen, den Hesse zunächst annahm, dann aber, enttarnt, zurückgeben musste.
Was sich im »Demian« offenbart, ist die Weltsicht eines Mystikers, für den es ein Verstehen überhaupt nur im Zustande der Innigkeit gibt. Mit anderen Worten, nicht was, sondern wie wir sehen, ist entscheidend. Aber damit wird alles Verstehen, die ganze Welt vor unseren Augen, zurückgeworfen auf uns selbst. Das ist nicht nur jene Lust geradezu grenzenloser Verfügbarkeit, sondern auch immer wieder die einer untragbaren Last: es ist zu viel. Klingsor, die Stimme orgiastischer Erkenntnisseligkeit, erklang darum auch nur einen kurzen Sommer lang: »Man überschätzt die Sinne, wenn man das Geistige nur als einen Notersatz für fehlendes Sinnliches ansieht. Das Sinnliche ist um kein Haar mehr wert als der Geist, so wenig wie umgekehrt. Es ist alles eins, es ist alles gleich gut. Ob du ein Weib umarmst oder ein Gedicht machst, ist dasselbe. Wenn nur die Hauptsache da ist, die Liebe, das Brennen, das Ergriffensein, dann ist es einerlei, ob du Mönch auf dem Berge Athos bis oder Lebemann in Paris.« Aber der Klingsor-Stachel bleibt, auch in der Krise: Natur und Geist gehören zusammen.
Symbol für dieses Zugleich wird im »Demian« der mythische Ur-Vogel Abraxas. Im zeitgleich entstandenen Dostojewski-Aufsatz »Die Brüder Karamasow oder der Untergang Europas« spricht Hesse diese für ihn neue Erfahrung aus: Es gibt keinen Gott, der nicht zugleich ein Teufel wäre, keine Befreiung ohne neue Knechtschaft, kein Heil ohne Unheil. Die Erlösung bleibt immer auf halben Wege stecken. Wissen wird zum Nicht-mehr-weiter-Wissen. Das Doppelgängerthema dominiert. Jedes Ding hat seine uns abgewandte Seite, seinen geheimnisvollen Doppelgänger. Hesse greift hier noch hinter Dostojewski zurück zu den Spiritualisten des 17. Jahrhunderts, die er aus seinem Elternhaus kennt. Da ist man auf der Suche nach dem »Geheimnis der göttlichen Sophia« - einer Weisheit, die weiblich ist, die man lieben kann. Hesse folgt darin Jakob Böhmes Ideal des »androgynen Adams«. Der Hermaphrodit vereinigt in sich den Gegensatz von männlich und weiblich. Seit seiner Psychoanalyse bei dem C.G. Jung-Schüler Lang (1916) und dann noch einmal bei C.G. Jung selber (1921) weiß Hesse: das Weibliche und das Männliche widerstreiten auch in ihm - als Schichten seines Ich. Man kann sie nicht einfach ans Licht zerren, denn die verborgen bleibenden Stützen geben dem Ich erst Halt.
Was kann man also tun, um sich ihrer bewusst zu werden? Ihnen eine symbolische Gestalt geben. Emil Sinclair und sein anderes Ich Max Demian gehören zusammen. Demian wird dabei zum »Seelenführer«, zum Erwecker Sinclairs. Allzu soziologische Geister der Post-68er-Bewegung haben hier einen profaschistischen Führerkult angelegt gesehen. Das Gegenteil ist der Fall: »Werde der du bist« - steht über diesem Buch, das ein Versuch ist, die destruktive Seite in unserer Persönlichkeitskonstruktion anzuerkennen.
Und Hesse treibt das Thema seiner Selbstbewusstwerdung noch weiter, weitet es - vor dem Hintergrund des erlebten unheilvollen Helden-Rauschs, der jämmerlichen Kriegs-Trunkenheit - zu einem gesellschaftspsychologischen Porträt einer in die Katastrophe (Weltkrieg, psychischer Zusammenbruch) mündenden End-Zeit. Darin gleicht der »Demian« Thomas Manns »Zauberberg«. Das angestrengt Verdrängte bricht blindlings aus, das Chaos überfällt die Ordnung um so grausamer, je mehr man es vorher weggesperrt, geleugnet hat.
Das ist Hesses traumatische Erfahrung, um deren Ausdruck er im »Demian« ringt. Vernunft ist, unserer Natur eine kulturell-lebbare Form zu geben. Das Triebhaft-Nächtliche, das Selbst-Zerstörerische - es gehört zu uns. In uns allen stecken Kain und Abel, lautet Hesses Botschaft. Wir müssen uns unsere Verführbarkeiten eingestehen, um uns gegen sie zu wappnen. Nur erfahrene Gebrochenheit schützt vor dem ungebrochenen Gang der Gerechten - auf dem geraden Weg in den Abgrund. Erziehung (ein Thema, das ihn lebenslang peinigte) erhält einen Sinn nur da, wo die Lebenslügen Gerichtstag über sich selbst halten. Da finden wir dann vielleicht einige Wahrheitskörner. Hesse ist im »Demian« unbedingt auch in seinen Selbstbescheidungen: »Wir müssen nicht hinten beginnen, bei den Regierungsformen und politischen Methoden, sondern wir müssen vorn anfangen, beim Bau der Persönlichkeit, wenn wir wieder Geister und Männer haben wollen, die uns Zukunft verbürgen.«
Gunnar Decker, Autor zahlreicher Bücher, veröffentlichte bei Reclam Leipzig den Band »Hesse-ABC« (259 Seiten, brosch., 9,90 EUR).
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.