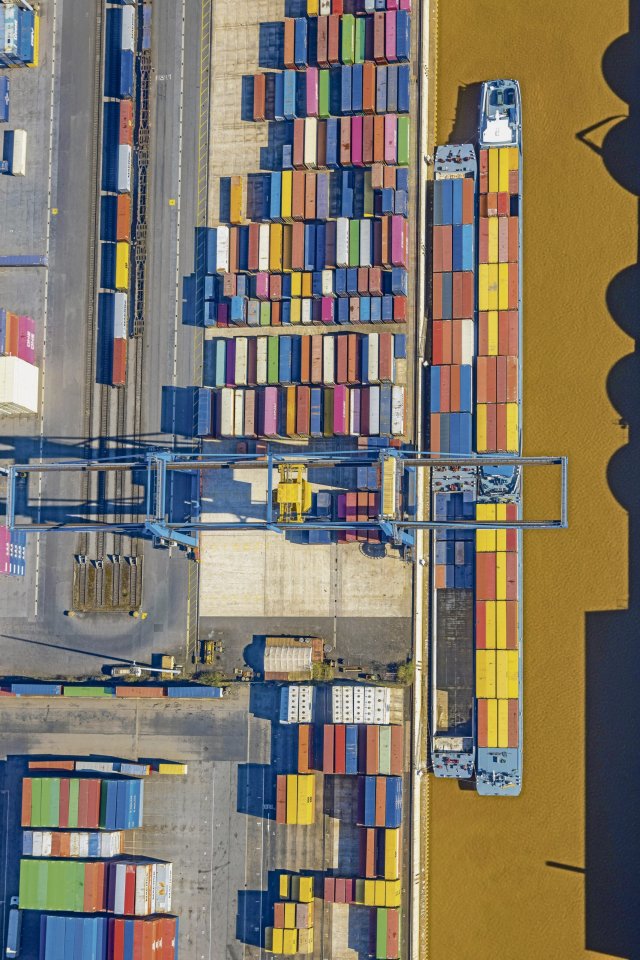Das vergessene Jubiläum
Vor 45 Jahren wurde die Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald eingeweiht - Streit um Form und Inhalt des Gedenkens an die Opfer des Naziregimes begleiteten ihre Geschichte
Kein Ehrenmal neben der Fürstengruft
Keine Rede war von den vorausgegangenen Auseinandersetzungen um Art und Form des Gedenkens an die Opfer des Konzentrationslagers, in dem insgesamt über 239000 Menschen gelitten haben und mehr als 53000 starben oder ermordet wurden. Einer Dokumentation der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora zufolge hatte im Dezember 1945 der einstige politische Häftling Werner A. Becker von der sowjetischen Militärkommandantur die Genehmigung erhalten, ein Ehrenmal für die Häftlinge auf dem Stadtfriedhof zu errichten. Dem stellten sich andere politische Häftlinge entgegen und verhinderten das Vorhaben. Kein geringerer als der damalige Direktor der Staatlichen Hochschule für Baukunst und Bildende Kunst in Weimar, Hermann Henselmann, sprang ihnen zur Seite und konterte: »Es ist unter allen Umständen abzulehnen, dass dieses Ehrenmal unmittelbar neben der Fürstengruft aufgestellt wird.« Er verstand das auch politisch zu begründen. Da die Fürstengruft Erinnerung an ein »ungeheures Traditionsgut« sei und die KZ-Häftlinge einer anderen Zeit angehörten, würde die »Reaktion« die unmittelbare Nachbarschaft als »Angriff auf die humanistische Tradition auswerten«.
Der Streit um das Gedenken zog sich über Jahre hin. Mehrfach wurden Entwürfe angefertigt und wieder verworfen. 1950 beschloss das SED-Politbüro, dass vom einstigen KZ nicht mehr als ein Bruchteil bewahrt werden solle. Allen Protesten zum Trotz begann im Mai 1952 der Abbruch des Lagers - eine Entscheidung, die möglicherweise mit der etwa zeitgleichen Auflösung des Speziallagers zusammenhing, das nach Kriegsende auf dem Territorium des KZ eingerichtet worden war. Die Ziegelsteine aus den abgerissenen Häusern und Baracken wurden an den Kreis Jena, die Evangelische Kirche und verschiedene kleine Baufirmen verteilt.
In ohnmächtigem Protest klagte 1956 der vormalige Leiter der Abteilung »Opfer des Faschismus« des Landesamtes für Arbeit in Weimar, Karl Straub, in Buchenwald seien große Fehler begangen worden, die nicht mehr gut zu machen seien. Gegen seinen Willen und »mit Zustimmung unserer eigenen Organe« sei das Lager abgebrochen worden. Da dürfe man es »den westdeutschen Faschisten nicht verübeln, wenn sie das gleiche tun«.
Auch das von Fritz Cremer entworfene Mahnmal war nicht unumstritten. Die Auseinandersetzung darüber sowie Materialprobleme führten schließlich dazu, dass die Einweihung der Gedenkstätte um ein Jahr verschoben werden musste. Gut 50 Jahre später, im Juli 1998, geriet Cremers Denkmal in die Schlagzeilen, als Jugendliche aus der rechten Szene eine Figur schwer beschädigten. Das hätten sich die befreiten Häftlinge im Augenblick des Schwures von Buchenwald nicht vorstellen können, dass es wieder möglich sein könnte, nazistisches Gedankengut zu verbreiten, kommentierte Reinhard Lochmann, Vorsitzender der deutschen Lagergemeinschaft Buchenwald und Dora, die Tat. Die Schuldigen wurden rasch gefasst und verurteilt. Inzwischen musste die Cremer-Plastik abgebaut werden, weil sie nicht mehr standfest war. Bis zum 60. Jahrestag der Selbstbefreiung des KZ in zwei Jahren soll sie restauriert wieder auf ihrem alten Platz stehen.
Streit um die Selbstbefreiung
Nach 1990 entbrannte ein heftiger Streit um die Selbstbefreiung der Häftlinge von Buchenwald. 21000 Menschen erlebten im Lager das Ende des Krieges. Inzwischen wird diese Selbstbefreiung auch in den offiziellen Veröffentlichungen der Gedenkstätte nicht mehr bestritten. Statt dessen wird eingeräumt, dass die Widerstandsgruppen der Häftlinge nicht passiv abwarteten, sondern den erste Augenblick nutzten, um die Wachtürme zu besetzen, die weiße Fahne zu hissen und das Lager für zwei Tage zu sichern, bis am 11. April die erste Panzerspitze der 3. US-Armee das KZ erreichte. Am 19. April leisteten die Überlebenden bei einer Trauerfeier für die Toten des KZ den historischen Schwur von Buchenwald, der in die Sätzen mündete: »Die endgültige Zerschmetterung des Nazismus ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ideal.«
Auch die Nachkriegsgeschichte Buchenwalds löste in den 90er Jahren ideologischer Auseinandersetzungen aus. Den Anstoß gaben ehemalige Insassen des sowjetischen Speziallagers Nr. 2, in dem zwischen 1945 und 1950 auf der Grundlage von Alliierten-Beschlüssen 28455 Menschen inhaftiert waren. Der Aufbau eines Dokumentationszentrums für dieses Lager führte zu heftigem Streit mit Überlebenden des KZ. Die Auseinandersetzungen gipfelten in einer öffentlichen Anhörung der Bundestags-Enquètekommission »Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der deutschen Einheit« 1996 in Buchenwald, auf deren Grundlage »gesamtdeutsche Formen der Erinnerung an die beiden deutschen Diktaturen und deren Opfer« erarbeitet werden sollten. Während Vertreter von CDU und CSU forderten, deutlicher darzustellen, dass die Lager zur »Ausstattung totalitärer Regime« gehörten, warnte der SPD-Historiker Bernd Faulenbach gerade davor, die Ausstellungen an der Totalitarismustheorie zu orientieren, weil sich die »Verschränkung verschiedener Vergangenheiten« sehr schwer darstellen lasse.
Respekt vor den Opfern
Für den Direktor der Gedenkstätte Buchenwald, Volkhard Knigge, ist der Respekt vor den Opfern die wichtigste Arbeitsvoraussetzung. Das bedeute für ihn auch, sich nicht instrumentalisieren oder missbrauchen zu lassen, betonte er vor der Kommission. Er sieht im Umgang mit dem Thema zweierlei Defizite. In der DDR sei die Geschichte der Konzentrationslager instrumentalisiert und heroisiert worden. Was diesem Ziel nicht entsprach, habe man ausgeklammert. Im Westen dagegen habe das Verdrängen im Vordergrund gestanden. Niemand habe dort den früheren KZ-Häftlingen die Tür zum Gedenken geöffnet. Eine Kommission zur Aufarbeitung des NS-Unrechts habe es nicht gegeben und die fundierte Forschung zu den alliierten Lagern habe erst sehr spät begonnen. Knigge, der sich als Anwalt beider Häftlingsgruppen versteht, warnte - bezogen auf Gedenkstättenkonzepte - vor dem »Illustrieren einer neuen Ideologie«. Das schaffe wieder Unglaubwürdigkeit. Leid müsse respektiert und dürfe nicht benutzt werden.
Zum Leid der KZ-Häftlinge gehört ein letztes dramatisches, tragisches Kapitel. Über 25000 von ihnen wurden kurz vor Kriegsende, im April 1945, auf Todesmärsche geschickt. Viele von ihnen überlebten die Tortur nicht. Am Abend des 13. Aprils 1945 beispielsweise hatten SS-, Volkssturm- und Wehrmachtsangehörige die Feldscheune des Gutes Isenschnibbe bei Gardelegen (Sachsen-Anhalt) angezündet, in der 1000 Häftlinge zusammengepfercht waren und grauenvoll in den Flammen umkamen. Daran wird erinnert - nicht am Sonntag, dem 45. Jahrestag der Eröffnung der Mahn- und Gedenkstätte in Buchenwald, sondern am Montag in der Letzlinger Heide. Dort wollen mehr als 200 Schüler beim Projekt »Weg des Lebens« der Länder Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen der Opfer der Todesmärsche gedenken.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.