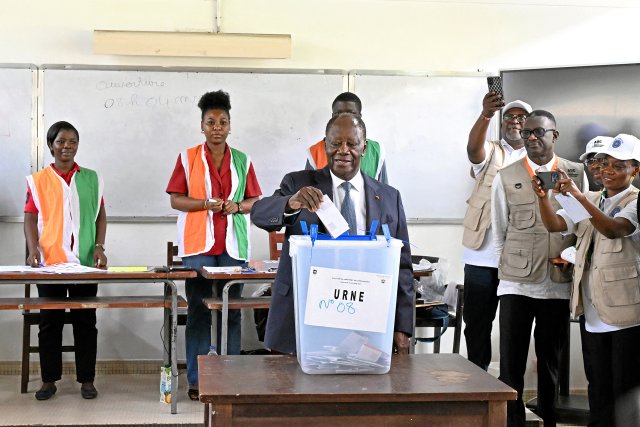Ankunft und Abschied
Zuflucht Palästina - Rachel und Kurt Stillmann erinnern sich
Nach Palästina sind beide in den 30er Jahren gekommen, kennen- und liebengelernt haben sich die gebürtige polnische Jüdin und der deutsche Jude in Tel Aviv. Gemeinsam mit ihren Freunden feierten sie im Mai 1948 euphorisch die Gründung des Staates Israel: Rachel (Jg. 1929) und Kurt Stillmann (Jg. 1916).
? Wie haben Sie die Proklamation des Staates Israels erlebt, was empfunden?
Rachel: Wir haben uns wie alle anderen sehr gefreut, gejubelt, getanzt, die Nacht zum Tag gemacht. Um diesen Traum eines eigenen jüdischen Staates Wirklichkeit werden zu lassen, haben wir ja selbst viel getan. Ich war damals im kommunistischen Jugendverband, mein Mann in der Kommunistischen Partei Palästinas - wir haben an Demonstrationen teilgenommen, Plakate geklebt, Flugblätter verteilt, um die Staatsgründung zu forcieren. Nach der Shoah gab es keinen Zweifel, daß ein Staat der Juden berechtigt, legitim sei. Daß dieser Staat gegründet worden ist - das ist eine historische und eine gerechte Wahrheit. Ich hätte es mir sehr gewünscht, wenn die Araber damals auch ihren Staat errichtet hätten. Die ganze politische Landschaft im Nahen Osten sähe heute anders aus. Und die vielen Opfer der letzten fünf Jahrzehnte wären vermeidbar gewesen.
? Sie sind nicht in Palästina geboren ...
Rachel: Ich war noch ein Kleinkind, als meine Eltern - über Berlin - aus Lublin nach Palästina gingen, vor dem Antisemitismus in Polen flohen. Ich wuchs in Tel Aviv auf, besuchte dort die Schule, lernte Kindergärtnerin. Tel Aviv ist meine Stadt - und ist es geblieben, bis heute.
? Aber »Ihre Stadt« haben Sie 1951 verlassen, Sie gingen in die DDR. Warum?
Rachel: Ich bin Kurt gefolgt, war verliebt und abenteuerlustig. Wäre mein Mann damals nach New York gegangen, wäre ich ihm dorthin gefolgt.
Kurt: Als ich Hitlerdeutschland verlassen hatte, stand für mich fest, daß ich zurückkehren würde, sobald der ganze Spuk vorbei ist.
? Diesen Entschluß machten Sie aber erst fünf Jahre nach Kriegsende wahr?
Kurt: Die Partei hat mich noch zurückgehalten. Sie sagte: »Wir sind im Grunde genommen eine Partei von Emigranten, was wird aus uns, wenn nun alle dorthin zurückgehen, woher sie gekommen sind?«
Rachel: Mein Mann war, wie man so sagt, ein Parteiarbeiter Als die erste Wahl zur Knesset stattfand, bat man ihn noch, in der Wahlkommission des Landes mitzuarbeiten: »Das ist dein letzter Job
in der Partei, dann kannst du gehen.« -Im übrigen hatte sich mein Mann sehr schnell akklimatisiert. Im Gegensatz zu vielen Flüchtlingen der fünften Alija, die vor allem »Jackes«, deutsche Juden, ins Land brachte. Denen wird bis heute nachgesagt, daß sie noch immer in Berlin oder Wien lebten. Mein Mann hingegen hat sehr schnell hebräisch gelernt und fand sich gut zurecht in der für ihn doch fremdartigen Kultur
? Ihrer beider jüdischer Hintergrund ist sehr verschieden?
Rachel: Ja. Ich komme aus einem traditionellen jüdischen Elternhaus. Meine Mutti war religiös, mein Vater Mitglied einer linkszionistischen Gruppierung.
Kurt: Mein Vater fühlte sich in erster Linie als Deutscher Deshalb wollte er auch nicht mit nach Palästina. Er gehörte zu der Generation, die sagte: »Ich bin
Deutscher, habe für mein Vaterland gekämpft, ich verlasse meine Heimat, mein Berlin nicht.« Während ich mich 1937 über Italien nach Palästina durchgeschlagen habe, blieb mein älterer Bruder beim Vater, um ihn noch zu überreden. Es gelang nicht. Am 31. August 1939 überschritt mein Bruder die belgische Grenze - einen Tag später war Krieg.
? Was geschah mit Ihrem Vater?
Kurt: Er starb in Theresienstadt. Das genaue Todesdatum haben wir erst 1991 erfahren, als wir in Yad Vaschem waren.
Rachel: Dort habe ich auch versucht, etwas über das Schicksal der Geschwister meiner Eltern in Erfahrung zu bringen. Es fehlt jede Spur von ihnen. Ich weiß nur, daß eine Schwester meiner Mutter nach Majdanek kam und ein Bruder meines Vaters als Kommunist hingerichtet worden ist. Die Familien meiner Eltern sind von den Nazis »ausgerottet« worden.
? Und da sind Sie nach Deutschland gegangen?!
Rachel: In die DDR. Es hieß, daß ein neues Deutschland, ein sozialistisches, aufgebaut wird. Mein Mann wollte mittun - und ich nicht zurückstehen.
? Wie nahm Sie die DDR auf?
Kurt: Sie hat mich gleich nach Indien geschickt, als Handelsvertreter.
Rachel: Nach einem Jahr aber mußte er aus dem Staatsapparat wieder ausscheiden. Der Slansky-Prozeß in Prag warf seine Schatten nach Ostberlin. Bis 1961 war mein Mann ohne festen Arbeitsplatz. - Das hat man aber alles weggesteckt. Denn das Unrecht, das einem da passierte, kam einem klein und nichtig vor gegen die großen Verbrechen, die in den Jahren zuvor im Namen des »deutschen Volkes« geschehen waren.
? Bereuten Sie irgendwann, nicht in Israel geblieben zu sein?
Kurt: Nein.
Rachel: Ja. - Aber wir hatten ein sinnerfülltes Leben in der DDR. Es war ja nicht so, wie man uns das jetzt weis machen will, daß wir arm gewesen seien, geistig und materiell. Ja, wir hatten
Schwierigkeiten - mein Mann und ich wie viele andere. Aber wir haben nicht Trübsal geblasen, waren lebensfrohe und lustige Menschen. Mein Mann kam, nachdem die ganzen »dummen Geschichten« ausgestanden waren, in den diplomatischen Dienst. Ich habe Psychologie studiert, promoviert und lehre seit 1972 mit Unterbrechungen, wegen der Auslandseinsätze meines Mannes - Hebräisch an der Humboldt-Universität. Jetzt im letzten Semester, auch die Israelwissenschaften werden abgewickelt...
Wissen Sie, als wir nach der »Wende« wieder nach Israel fuhren und auch den Kibbuz Giv'ath Chajim aufsuchten, in dem Kurt 1937 bis 1939 gearbeitet hatte, sprach jemand meinen Mann an: »Dich kenn ich, du bist doch der Jacke mit den blauen Augen. Siehst du, da bist du damals weggegangen, in dein Deutschland, um den Sozialismus aufzubauen. Was ist aus deinem Sozialismus geworden? Und wir, wir sind immer noch da.«
? Aber auch die Kibbuzim sind im Niedergang begriffen.
Rachel: Das ist sehr sehr traurig. Es war eine Möglichkeit gewesen, anders zu leben, schon fast so etwas wie eine sozialistische Lebensform, die dort praktiziert wurde: Gemeinschaftlichkeit, Brüderlichkeit, Solidarität.
Kurt: Ich habe auch in Ben-Shemen gearbeitet, dem Kinderdorf, in dem Shimon Peres und viele andere spätere Politiker Israels lernten. Ich war dort Ausbilder Gegründet worden ist Ben-Shemen von einem Berliner Reformpädagogen, Dr Siegfried Lehmann - getragen von humanistischen Ideen, Liebe zur Arbeit, Achtung vor den Mitmenschen.
Rachel: Ben-Shemener leben in der ganzen Welt verstreut. Es gibt einen Freundeskreis der ehemaligen Ben-Shemener Mein Mann gehört dazu. Sie unterhalten regen Kontakt. Es wäre schön, wenn die Ben-Shemener Idee überall leben würde, es keine Zwietracht, keinen Haß, keine Rivalität mehr unter den Völkern gäbe - auch und endlich in Nahost. Interview: Karlen Vesper Foto: Burkhard Lange
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.