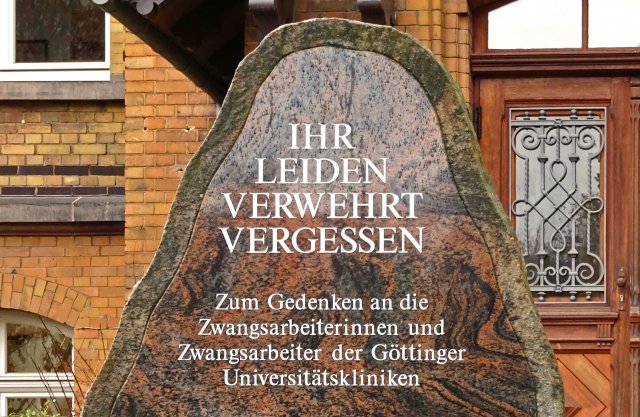- Politik
- Vor 70 Jahren starb Paul Levi, ein demokratischer Sozialist
Es gibt nichts Schlimmeres als feindliche Brüder
Berlin, Lützow-Ufer 37 Wenige Wochen vor seinem 47 Geburtstag, am 9 Februar des Jahres 1930, stürzte Paul Levi im Fieber aus dem Schlafzimmerfenster seiner Dachgeschosswohnung. Als er zu Grabe getragen wurde, waren mit roten Nelken und roten Fahnen erzgebirgische und vogtländische Arbeiter dabei - von ihnen war das Mitglied der SPD im Wahlkreis Zwickau-Plauen zwei Mal in den Deutschen Reichstag gewählt worden. Sie sprachen respektvoll von »unserem Paul« und hatten auf die Schleifen das Kranzes geschrieben: »Dem Bannerträger der Revolution«.
Dies entsprach jedoch nicht den Urteilen, die es über ihn in seiner Fraktion und seiner Partei gab. Auch nicht denen der KPD deren Vorsitzender er in den frühen 20er Jahren gewesen war. Während der Gedenkveranstaltung im Parlament für den verstorbenen Abgeordneten verließ die kommunistische Fraktion den Saal. Gleiches taten die Nazis, was nicht ver wunderte - Levi war Antifaschist, hatte die Militarisierung des öffentlichen Lebens kritisiert und als Anwalt »Landesverräter« verteidigt. Als »Fememordjude« hatten sie ihn beschimpft, nachdem er 1926/27 erfolgreich als Berichterstatter des Reichstagsausschusses zur »Untersuchung der Femeorganisationen und Fememorde« tätig gewesen war.
Gelegentlich hat Paul Levi geäußert, für ihn gäbe es nichts Schlimmeres als feindliche Brüder. Was sind Brüder, was Feinde? Dies bleibt bis in unsere Tage zu fragen, nicht zuletzt auch mit dem Blick auf seltsame Aufgeregtheiten in einer Debatte, in der neuerlich Engagement und Ziel demokratischer Sozialisten bestimmt werden sollen. Es hätte den humanistischen Marxisten Levi mit Zorn und Empörung erfüllt, müsste er sehen, wie es in dieser Debatte mitunter allzu vordergründig um die Befriedigung von purer Streitsucht zu gehen scheint, um Frontenbildungen nach wirklichkeitsfremden Kriterien bipolarer Ausschließlichkeit, »entweder-oder«.
An Paul Levi - von dem es während der Novemberrevolution hieß, er sei neben Liebknecht und Luxemburg das dritte große »L« - schieden sich im damaligen Deutschland die Geister; und selbst die Erinnerung an ihn trennt Jahrzehnte danach allzu oft Linke in Deutschland voneinander, die in Vergangenem Bewahrens- und Traditionswürdiges suchen oder befürchten, sozialistische Ziele wür den rigoros über Bord geworfen. Als sich Levi 1920/21 gegen putschistische Tendenzen in seiner Partei wandte, wurde ihm vorgeworfen, es fehle an pathetischem Schwung und großer Gebärde eines traditionellen Revolutionärs. Dem hielt er entgegen, ihm sei »die vielleicht äußerlich gesehene geringe Arbeit des letzten Funktionärs im Betrieb oder in der Gewerkschaft lieber als alle revolutionäre Psychopathie...«
Der Sohn einer bürgerlich-jüdischen Familie hatte eine gediegene Ausbildung genossen und sich zu einem glänzenden Juristen entwickelt. Geschildert wird er als begnadeter Redner. Die menschliche und politische Nähe zu Rosa Luxemburg brachte ihn in die Politik. Vieles verband beide miteinander- die Liebe zueinander und zur Natur ebenso wie politischer Scharfsinn, Hass gegen jegliche Ungerechtigkeit und Menschenverachtung, die strikte Ablehnung des Krieges wie auch das Streben nach Unabhängigkeit. »Geistig frei und niemandes Knecht« - so lautete ihr Wahlspruch für den von ihnen angestrebten Sozialismus.
Doch Levi war keineswegs nur ein Schüler der Rosa. Er ist sehr wohl selbst als ein originärer Denker zu sehen. Seine politische Konsequenz und Unbeugsamkeit erscheinen bewunderungswürdig, ebenso seine Kreativität und Streitbarkeit, die sich stets dem demokratischen Sozialismus zuordneten, ja auch seine Eigenwilligkeit in allen Fragen, die das Verhältnis zwischen Arbeiterparteien und Ar beitermassen betrafen. Seine Kritik richtete sich gegen bürokratisch funktionierende Apparate - gemeint waren u. a. die Kommunistische Partei Sowjetrusslands und die Kommunistische Internationale - und gegen so genannte Berufsrevolutionäre, die keine eigene Meinung besitzen und sich anderen unterordnen. Bedenkenswert sind nicht zuletzt auch seine ständigen Bemühungen, die geeignetesten Organisationsformen für erfolgreiches Ringen um die ihm unabdingbar erscheinende Alternative zu Krieg, Kapitalismus und Faschismus zu suchen. Nur der, der kritisch denkt - so hieß es bei ihm - »ver mag die Wahrheit von der Lüge, den Edelstein vom Schutt zu sondern«.
Vom Frühjahr 1919 bis zum 24. Februar 1921 stand er an der Spitze der jungen, von außen brutal bekämpften und inner lieh arg zerstrittenen KPD Am 15. April 1921 schloss ihn deren neue Führung »wegen schwerer Parteischädigung und Vertrauensbruch« aus. Die frühe Geschichte der KPD ist dennoch untrennbar mit seinem Namen verbunden, vor allem durch jene Dokumente, die einen anderen Weg wiesen, als er dann und mit fatalen Folgen begangen worden ist. Paul Levi sorgte sich mehr um das Wohl und Wehe der proletarischen Massen als um das der Parteien. Mit tiefem Ernst verwies er immer wieder auf das Marxsche Manifest und den dort fixierten Grundsatz, dass die Kommunisten nie besondere, von den Interessen der Arbeiter losgelöste Interessen zu vertreten hätten. Jede simplifizierende oder gar beschönigende Analyse der Situation war ihm zuwider, wie sich bereits in den Tagen des ersten Putsches zeigte, den konservativ-reaktionäre Kreise unter der Leitung von Wolfgang Kapp im März 1920 gegen die Weimarer Republik anzettelten.
Von Levi stammt ferner der bekannte und richtungsweisende »Offene Brief« an alle deutschen Arbeiterorganisationen vom 8. Januar 1921. Dieses Dokument bekannte einsichtig, man könne sich zwar nicht über Demokratie und Diktatur miteinander verständigen, dringend sei jedoch die Einigung für den Kampf um ein Stück Brot, das für den mehrheitssozialdemokratischen und unabhängigen Ar beiter nicht weniger wichtig als für den Kommunisten sei. Über dieses sehr zeitbezogene Anliegen hinaus ging es ihm prinzipiell um die Unterordnung des Interesses von Parteien unter die unmittelbaren Interessen ihrer Mitglieder. Ganz in diesem Geiste rief Clara Zetkin kurze Zeit darauf (nach dem Mord an dem Zentrums-Politiker Matthias Erzberger, dem Unterzeichner das Waffenstillstandes vom 11. November 1918) zum Schutz der Weimarer Republik auf. Diese sei zwar nicht »die Erfüllung des proletarischen Kampfes«, jedoch sei sie ohne Unter schied der Partei als ein politischer Fortschritt zu werten sowie »gegen ihre Feinde zu verteidigen und zu schützen - wenn es sein muss mit dem Einsatz ihrer Freiheit, ihres Blutes, ihres Lebens«.
In Nachrufen politischer Freunde hieß es, nur der Tod habe ihm das Rückgrat brechen können. Und mit Bedacht formulierte Carl von Ossietzky für »Die Weltbühne« vom 18. Februar 1930: »Wenn die Geschichte einmal das Fazit der ersten zehn Jahre Republik zieht, dann wird sie Paul Levi mit Ehren überhäufen... Die Kommunisten taten Unrecht, ihn einen Abtrünnigen, die Sozialdemokraten, ihn einen Bekehrten zu nennen. Er war ein internationaler revolutionärer Sozialist aus Rosa Luxemburgs Schule, hat es nie verleugnet. Paul Levi war dem Sozialismus verschworen wie kaum ein anderer... Deshalb bedeutet sein Tod mehr als der irgendeines Politikers ...«
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.