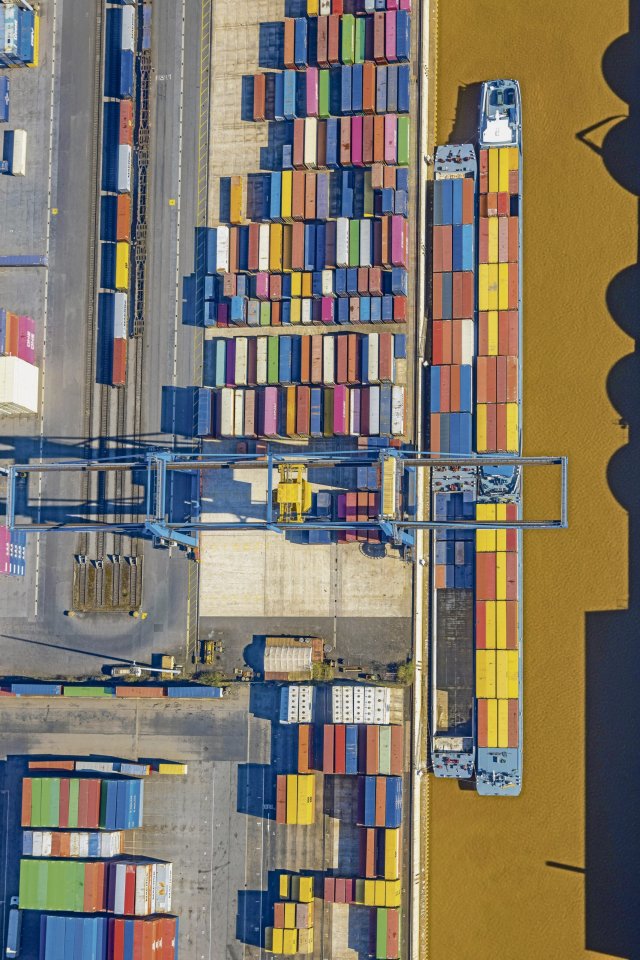50 Jahre sind vergangen, seit in der Volksrepublik Polen erstmals der Ruf nach einem »Sozialismus mit menschlichem Antlitz« laut wurde.
Es war nach dem XX. Parteitag der KPdSU im Februar 1956, auf dem Nikita Chruschtschow seine Rede »Über den Personenkult und seine Folgen« gehalten hatte. Die Enthüllung der stalinistischen Verbrechen war in ganz Polen in wenigen Tagen bekannt geworden: Der Text wurde in den Grundorganisationen der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (PVAP) verlesen und gelangte so an die Öffentlichkeit. Kurz danach verstarb in Moskau Boleslaw Bierut, der Erste Sekretär des ZK der PVAP. Nachfolger wurde Edward Ochab. Anfang April wurden die wichtigsten Verantwortlichen des berüchtigten Sicherheitsamtes UB festgenommen und aus der Partei ausgeschlossen. Aufgrund einer Amnestie wurden etwa 35 000 Menschen aus den Gefängnissen entlassen. In der studentischen Wochenschrift »Po prostu« erschienen Texte, die trotz strenger Zensur die »Übergriffe« des UB anprangerten und das stalinistische System kritisierten. »Lasst alle Blumen blühen« - diese von der KP Chinas im Mai ausgegebene Parole wurde in Polen als Unterstützung des aufziehenden »Tauwetters« verstanden. Zum ersten Mal war damals der Ruf nach »Sozialismus mit menschlichem Antlitz« zu vernehmen.
Signale der Unzufriedenheit der Arbeiterklasse mit den sozialen Folgen der im Eiltempo betriebenen Industrialisierung mehrten sich und verschärften das politische Klima. Krassester Ausdruck dieser Unzufriedenheit war Ende Juni der Streik in den Cegielski-Werken in Poznan. Daraus erwuchs eine Revolte, die vom Militär blutig niedergeschlagen wurde. Die Krise im Lande spitzte sich jedoch zu und ließ sich durch Drohungen nicht mehr bewältigen. Ministerpräsident Jozef Cyrankiewicz hatte gewarnt, man werde jede Hand abhacken, die sich gegen den Sozialismus erhebe. Auch die internationale Lage wurde immer nervöser. Ende Juli nationalisierte Oberst Nasser in Ägypten den Suez-Kanal, in Nordafrika gewann die Befreiungsbewegung an Kraft.
Ochab fuhr ins »Reich der Mitte« und sicherte sich Rückenstärkung für weitere Veränderungen in Polen. Wie er nach Jahren zugab, gelangte er Ende September zur Einsicht eigenen Unvermögens, die Lage zu meistern. Überall war der Ruf zu hören, Wladyslaw Gomulka, der 1948 abgesetzte Generalsekretär der damaligen Polnischen Arbeiterpartei (PPR), müsse wieder an die Macht. Gomulka, jahrelang inhaftiert, war erst seit kurzer Zeit wieder auf freiem Fuß. Die Parteiorganisation der Autowerke im Warschauer Stadtviertel Zeran setzte sich mit ihrer Forderung nach Rückkehr Gomulkas durch. Als diese schon während eines ZK-Plenums als ausgemacht galt, erschien ungeladen Nikita Chruschtschow in Warschau, um Ordnung zu schaffen. Durfte man denn auch über einen Ersten Sekretär befinden, ohne in Moskau gefragt zu haben? Am 18. und 19. Oktober gab es dramatische Verhandlungen mit dem Mann aus Moskau. Sie wurden von Bewegungen sowjetischer Panzereinheiten in Polen begleitet. Aber auch polnische Einheiten marschierten auf. In China wurde gemurmelt. Chruschtschow flog nach Hause.
Am 21. Oktober wurde Wladyslaw Gomulka, ein Kommunist aus der Vorkriegszeit, der wegen angeblicher »nationalistischer Abweichung« auf Befehl Stalins gefeuert worden war, zum Ersten Sekretär gewählt. Drei Tage später jubelten ihm 300 000 Menschen in Warschau zu. Das war der Höhepunkt des »Polnischen Oktobers«. Der einzige Moment - so heißt es heute -, da die Massen mit der Partei aufs engste verbunden waren. Klar war die Lage noch längst nicht. Als Gomulka auf dem Paradeplatz rief »Genug der Kundgebungen, ran an die Arbeit!« war deutlich auch Unzufriedenheit zu hören. Es gab ja auch Kräfte, die von einer »zweiten Etappe« träumten. Doch in keinem einzigen Moment dachte die Partei damals daran, den Gegnern des Sozialismus das Feld zu räumen. Anders als in Budapest, wo am 26. Oktober die sowjetische Intervention begann.
Diese dramatische und traurige Tatsache vor Augen, setzte die polnische Führung der Liberalisierung Grenzen auch in der Frage der Arbeiterräte in den Betrieben. Mit Moskau wurde ruhig aber entschlossen verhandelt. Ungerechte Handelsabkommen wurden revidiert, die sowjetischen Berater wurden zurückgezogen, eine eigenständige Kultur-, Kirchen- und Landwirtschaftspolitik wurde Polen eingeräumt. Eine »kleine Stabilisierung« setzte ein. Der »Oktober« war bald passé.
Anders als vielen Gedenktagen, die im rechts regierten Polen offiziell gefeiert werden, fällt dem 50. Jahrestag des »Polnischen Oktobers« heute herzlich wenig Aufmerksamkeit zu. Nur in einigen linken Zeitschriften wird daran erinnert, was vor einem halben Jahrhundert in Polen geschah.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.