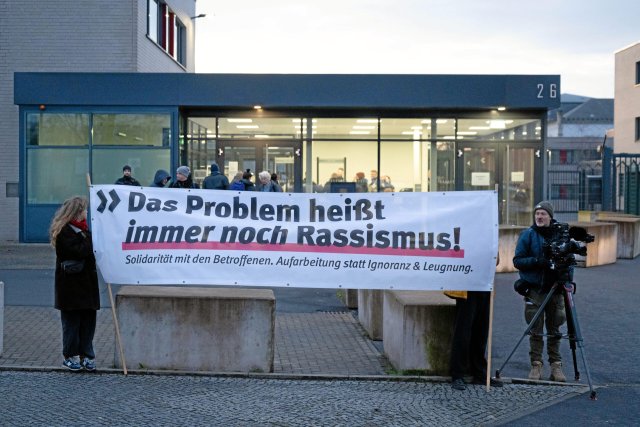Dein Freund und Helfer in Thüringen hört mit
Polizei schnitt heimlich Zehntausende Telefonate mit
In Dienststellen der Thüringer Polizei sollen einem Medienbericht zufolge jahrelang heimlich Telefonate mitgeschnitten worden sein. Seit 1999 seien offenbar Zehntausende von Gesprächen ohne Wissen und Zustimmung der Anrufer und Angerufenen automatisch aufgezeichnet worden, berichtete MDR Thüringen.
Der Staatsanwalt aus Gera, der die Sache schließlich hat auffliegen lassen, war konsequent: Als ihn im Februar 2016 ein Polizist anrief, um mit ihm über einen Fall zu sprechen, konfrontierte der Jurist den Polizisten mit der Frage, ob dieser Anruf – wie er gehört habe – aufgezeichnet werde; ohne, dass der Staatsanwalt seine Einwilligung dazu gegeben hatte. Ja, sagte der Polizist. Der Staatsanwalt beendete daraufhin das Gespräch. Er weigerte sich solange mit einem Polizisten über den Fall zu sprechen, bis er von der Polizei über ein Handy angerufen wurde, das die Telefongespräche nicht mitschneiden kann. Und damit der Konsequenz nicht genug: Kurz darauf stellte der Staatsanwalt Strafantrag wegen dieser Abhör-Praxis. Er sehe dadurch die Vertraulichkeit des Wortes verletzt, argumentiert der Jurist. Das ist eine Straftat. Eine, die aus seiner Sicht umso schwerer wiegt, weil sie von einem Amtsträger begangen worden sein soll.
Seit diesem Mittwoch nun ist nicht nur dieser eine Fall des Mitschneidens von Telefongesprächen durch die Thüringer Polizei öffentlich. Im Nachgang des Berichtes ist auch klar geworden: Was dem Staatsanwalt passierte, ist seit Ende der 1990er Jahre gängige Praxis bei der Landespolizei gewesen. Viele Hintergründe und Fragen dazu sind zwar noch offen. Die Gewerkschaft der Polizei sieht aber schon jetzt einen massiven Vertrauensverlust in das Ministerium – während die Staatsanwaltschaft Erfurt wegen des Strafantrages aus Gera und eines weiteren, später eingegangenen Strafantrages ein Ermittlungsverfahren führt; der Landesdatenschutzbeauftragte Thüringens eigene Prüfungen anstellt; die Landtagsfraktionen Aufklärung fordern und das Innenministerium die bisherige Abhör-Praxis erst einmal gestoppt hat sowie die Sache nun intern aufarbeitet.
»Ein Datenschutzskandal von immensem Ausmaß zeichnet sich ab. Jetzt muss alles dafür getan werden, Licht in die Überwachungspraktiken zu bringen und den Skandal aufzuklären«, forderte Susanne Hennig-Wellsow, Vorsitzende der Linksfraktion in einer ersten Stellungnahme. Die Instrumente der parlamentarischen Kontrolle müssten jetzt »umfassend genutzt werden«.
Dass neben den – das ist unstrittig – legal aufgezeichneten eingehenden Notrufen auch Telefongespräche automatisch aufgezeichnet worden sind, die von bestimmten Polizeitelefonen aus geführt wurden, geht nach Angaben eines Sprechers des Thüringer Innenministeriums auf eine Dienstanweisung aus dem Jahr 1999 zurück. Damals war das Notruf-System in Thüringen noch anders aufgebaut als heute: Die Notrufe gingen noch in einzelnen Flächendienststellen ein.
Heute laufen sie im Normalfall in einer zentralen Einsatzzentrale in Erfurt auf. Allerdings stehen in den Flächendienststellen noch immer die alten Notruf-Telefone – die weiter benutzt werden und auch nach Gründung der Einsatzzentrale weiter aufgezeichnet haben – damals wie heute auch dann, wenn jemand über die direkte Einwahl ins Polizeinetz diese Telefone ansteuerte, unabhängig von Notrufen; wie eben häufig Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Sozialarbeiter und manchmal auch Journalisten. Auch abgehende Nicht-Notruf-Gespräche von diesen Apparaten sollen aufgezeichnet worden sein.
Hat die Polizei einfach vergessen, diese Funktion bei den Telefonen in den Flächendienststellen zu deaktivieren? War das Mitschneiden der Direkt-Einwahl-Gespräche überhaupt jemals legal? Braucht man diese Funktion in den Flächendienststellen heute, als Rückfallebene, wenn die Landeseinsatzzentrale ausfällt? Was ist mit den aufgezeichneten Daten passiert? Zu all diesen Fragen gibt es gegenwärtig mehr Fragen als Antworten.
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Thüringen allerdings fordert wie so viele andere im Freistaat derzeit nicht nur Aufklärung, sondern sieht schon jetzt das Vertrauen zwischen den Thüringer Polizisten und dem Innenministerium stark beschädigt. Schon 2013, sagt der Landesvorsitzende der GdP, Kai Christ, habe es Gerüchte über Mithör-Praktiken an Diensttelefonen der Polizei gegeben. Weil das Ministerium das damals dementiert habe, es nun aber einräume, habe die Glaubwürdigkeit des Ressorts »extrem gelitten«.
Es müsse geklärt werden, ob es sich hier um bewusste Lügen handelte, forderte die LINKE-Politikerin Hennig-Wellsow. Die offenkundig flächendeckend und strukturiert erfolgte Überwachung von Polizeibediensteten sei unter der rot-rot-grünen Landesregierung beendet worden.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.