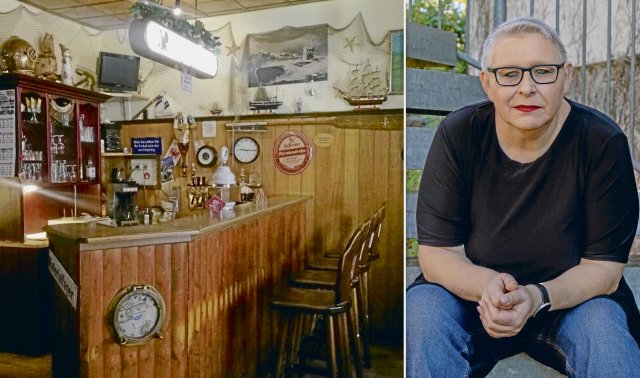Verloren, versteigert, verwendet
Einmal im Jahr bietet das Auktionshaus Assetorb Sachen an, die im zentralen Fundbüro abgegeben wurden
Der Teddybär hat schon bessere Tage gesehen. Sein beiges Fell und das rosa T-Shirt mit aufgedruckter Berliner Skyline sind leicht verblasst. Es ist Monate her, dass zuletzt mit ihm gespielt wurde - doch bald könnte es wieder so weit sein. An diesem Dienstag wird er im Paket mit anderen Kuscheltieren auf der Auktion des Zentralen Fundbüros Berlin versteigert. Dabei kommen Fundsachen unter den Hammer, die länger als sechs Monate nicht abgeholt wurden. Sechsmal im Jahr gibt es eine solche Versteigerung beim Auktionshaus Assetorb im Stadtteil Schöneberg.
Dort lagern die Fundsachen seit einigen Tagen in Regalen, sorgsam verpackt und katalogisiert. Dazu kommen etwa 150 Fahrräder in einer Halle. Seit mehr als 20 Jahren versteigert Assetorb die Fundsachen des Zentralen Fundbüros. Neben den lokalen Versteigerungen führt das Unternehmen nach eigener Aussage im Auftrag von Firmen Online-Auktionen mit nicht mehr benötigten Anlagen oder Maschinen durch. Die Fundsachen werden dagegen vor Ort versteigert.
Dafür braucht es keine Voranmeldung oder Bieterkarten. Per Handzeichen wird geboten und direkt in bar bezahlt - egal, ob man ein Fahrrad, drei Säcke Kleidung, ein Handy oder eine Brille ersteigert hat. Fünf Euro beträgt der Mindesteinsatz.
»Es gibt eigentlich nichts, was die Leute nicht verlieren«, schildert der Leiter des Zentralen Fundbüros Berlin, Manfred Schneider. Im vergangenen Jahr verloren die Berliner der Fundbüro-Statistik zufolge am häufigsten Einzeldokumente wie Geldkarten, gefolgt von Kleidungsstücken, Schlüsseln, Geldbörsen und Handys. Mehr als 30 400 Dinge wurden auf Straßen, in Grünanlagen oder Parks gefunden und zum Zentralen Fundbüro gebracht. Darunter auch Kurioses: Schneider erinnert sich etwa an eine Tätowiermaschine und ein Paket Dämmmatten.
Sechs Monate lang werden die Fundsachen dann am ehemaligen Flughafen Tempelhof gelagert. Mit einer Ausnahme: ungeöffnete Lebensmittel. »Die werden bis zum Ablauf der Haltbarkeit aufbewahrt«, sagt Schneider. Nur 20 Prozent der Fundsachen werden abgeholt. Wenn das nicht passiert, können sie versteigert werden. Auch hier gibt es Ausnahmen: Schlüssel, Dinge mit Namenshinweisen wie Anhänger oder Dokumente, zu stark Abgenutztes und Nahrungsmittel werden nicht verkauft. Diese Dinge werden laut Schneider entweder zum Aufarbeiten an gemeinnützige Einrichtungen gespendet oder vernichtet.
Bei der Versteigerung herrscht das Prinzip: Alles muss raus. Restbestände gibt es nicht. Meist dauert das ungefähr zweieinhalb Stunden für knapp 600 Fundsachen. Am Auktionstag können sich die Bieter das Angebot von 8 bis 10 Uhr ansehen, danach beginnt die Versteigerung. Etwa 200 Menschen sind laut Auktionshaus durchschnittlich dabei, Studenten genauso wie Geschäftsleute. Rund 80 000 Euro kommen so pro Jahr zusammen. Als städtische Einnahme fließt dieses Geld laut Fundbüroleiter Schneider in die »nicht unerheblichen Kosten für den Aufwand der Fundsachenverwaltung«. Damit wird auch der Teddy mit dem rosa T-Shirt zum Landeshaushalt beitragen - und hoffentlich wieder jemanden finden, der mit ihm spielt. dpa
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.