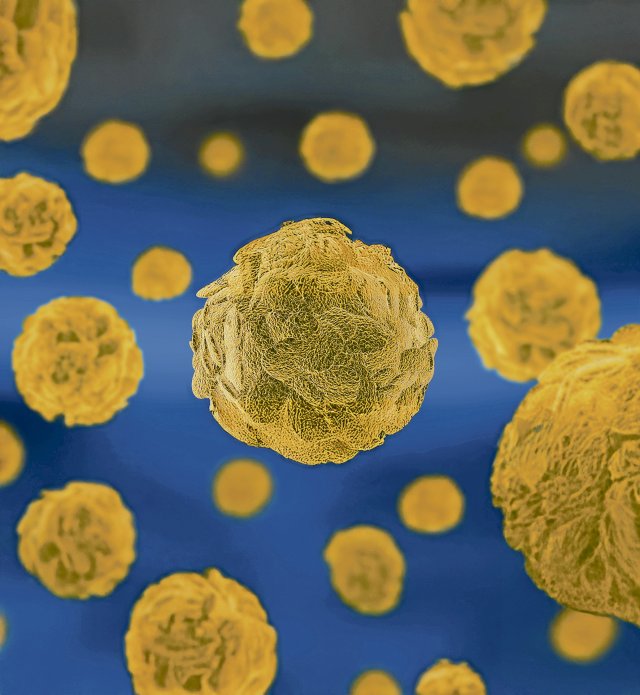Genauer mit Ultraschall und MRT
Experten fordern: Das Screening-Programm für Brustkrebs sollte weiter differenziert werden
Manchmal kriecht die Erinnerung hoch. Ein Arztzimmer, ein Schreibtisch, zwei Stühle. Sterile Atmosphäre. Auf dem Tisch liegt ein bedruckter Zettel, es ist der Überweisungsschein fürs Krankenhaus. »Lässt sich das nicht besser noch ein bisschen beobachten?«, fragt Andrea Idstein (Name geändert). »Sie haben Brustkrebs, da brauchen Sie nicht drumrumzureden«, lautet die schroffe Antwort des Mediziners. Es fühlt sich an wie ein Faustschlag.
Bis heute ist sich Andrea Idstein nicht sicher, ob die schnelle Operation und die Strahlentherapie bei ihrer Vorstufe von Brustkrebs wirklich nötig waren. »Da bleibt ein Zwiespalt«, sagt die 59-jährige Berlinerin. Gefunden wurden ihre Symptome im Rahmen des Mammografie-Screening-Programms. Es steht für eine Röntgenuntersuchung der Brust, ein kostenloses Krebsfrüherkennungs-Angebot für gesetzlich versicherte Frauen zwischen 50 und 69 Jahren in Deutschland. Kritiker sehen jedoch Probleme. »Das deutsche Screening-Programm ist eine Antwort auf die Herausforderung Brustkrebs, die vor 30 bis 40 Jahren angemessen war«, sagt Christiane Kuhl, Direktorin der Radiologischen Klinik an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. »Heute können wir aber sowohl das individuelle Risiko besser einschätzen, als auch daran angepasste Untersuchungsmethoden wählen.«
Andrea Idstein hat die Info-Broschüren der Kooperationsgemeinschaft Mammografie, die das Programm bundesweit koordiniert, nur überflogen. Von der Diskussion um Methoden wusste sie damals nichts. Ein Routine-Check. Das klang sinnvoll, warum nicht. Rund die Hälfte der angeschriebenen Frauen in Deutschland reagiert so. Nach der Mammografie bekam Andrea Idstein Post: eine Einladung zu weiterer Abklärung, weil das Röntgenbild Auffälligkeiten zeigte. Um Gewissheit über Brustkrebs oder Vorstufen zu bekommen, entnahmen Ärzte mit einer Nadel eine Gewebeprobe.
Diese Phase und das Warten auf ein Ergebnis ist für viele Frauen das Schwerste. »Man steht quasi neben sich«, sagt Idstein. »Das kann nur jemand nachfühlen, der das selbst erlebt hat.« Die Angst kommt nicht von ungefähr. Brustkrebs ist die Krebsart, die Frauen in Deutschland mit Abstand am häufigsten trifft. Rund 69 000 Neuerkrankungen gibt es im Jahr und 17 000 Todesfälle.
Bisher klingt das Screening-Programm nach einer Erfolgsgeschichte. »Bemerkenswert ist jetzt schon, dass die großen Brustkrebs-Karzinome in der Gesamtbevölkerung abnehmen«, sagt Frauenärztin Karin Bock, Leiterin des Referenzzentrums Mammografie Südwest in Marburg. Es gebe weniger große Tumoren, weil die kleinen früher entdeckt würden. Je weniger große Tumore, desto weniger Todesfälle durch Brustkrebs - das ist die Logik der Kooperationsgemeinschaft Mammografie.
Diese Argumentation ist für die Forscherin Christiane Kuhl nachvollziehbar. Dennoch findet sie, dass es an der Zeit ist, das Programm zu verbessern. Das Ziel von Früherkennung müsse heute sein, solche Karzinome möglichst früh zu entdecken, die potenziell tödlich sind. Auffälligkeiten, die ohne Behandlung keinen Schaden anrichten würden, sollten undiagnostiziert bleiben. Für diese Zwecke sei die Magnetresonanztomographie (MRT) der bislang allein empfohlenen Röntgen-Mammografie überlegen, und das ganz ohne Strahlenbelastung, so Kuhls Standpunkt.
Mit Erfahrungen zu MRTs in anderen Staaten kann sie allerdings noch nicht aufwarten. Große Untersuchungen dazu laufen noch oder beginnen gerade erst. Ende des Jahres werden Ergebnisse einer in den USA koordinierten Studie erwartet.
Welche Art von Tumoren findet man mit welcher Methode? Und wie hoch ist jeweils die Gefahr von Über- oder Unterdiagnosen? Die Ansichten dazu gehen in den Fachgesellschaften weit auseinander. Die Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (Degum) zum Beispiel ist der Meinung, dass Ultraschall das Mammografie-Screening ergänzen sollte. Damit könnten bis zu 45 Prozent mehr wuchernde Karzinome erkannt werden, heißt es dort.
»Es geht nicht darum, immer mehr Auffälligkeiten zu finden. Es geht darum, dass es weniger Brustkrebstote gibt«, betont Oliver Heidinger, Geschäftsführer des Krebsregisters in Nordrhein-Westfalen. »Das Mehr an Diagnosen ist da nicht automatisch ein Benefit.« Nach seiner Einschätzung ist das laufende Programm auf keinen Fall ein Fehler. »Wir produzieren hier ein lernendes System. Das hatten wir vorher nicht.«
Heidingers bisherige Ergebnisse sprechen aus seiner Sicht für das Mammo-Programm. Bei Frauen, die regelmäßig zum Check gingen, fänden Radiologen insbesondere aggressive Tumore. In der Gesamtbevölkerung der Stadt Münster zum Beispiel habe die Zahl fortgeschrittener Tumorstadien seit dem Start des Programms abgenommen.
»Das Screening ist Mindeststandard, aber sicher nicht der Goldstandard«, sagt Annette Kruse-Keirath, die der Patientenorganisation Allianz gegen Brustkrebs vorsteht. »Medizin kann mehr.« Frauen mit dichtem Brustgewebe etwa bräuchten keine Röntgenuntersuchung, weil man darauf ohnehin wenig sehe, sondern direkt einen Ultraschall oder ein MRT. »Wir brauchen einfach unterschiedliche Methoden der Früherkennung.«
Die Radiologin Kuhl sähe es als sinnvoll an, zunächst das individuelle Risiko einer Frau mit den inzwischen verfügbaren Mitteln möglichst genau zu ermitteln. Es gebe Frauen mit so niedrigem Brustkrebs-Risiko, dass regelmäßige Früherkennungs-runden eher unnötig sind. Solche, bei denen die Mammografie ausreiche. Und eben Frauen, die von Anfang an eine andere oder intensivere Früherkennung benötigen. »Weil sie zum Beispiel dichtes Drüsengewebe haben oder weil Familienangehörige bereits an Brustkrebs erkrankt sind«, erklärt Kuhl. »Oder weil Gewebeveränderungen festgestellt wurden, die ein erhöhtes Erkrankungsrisiko bedeuten.« Für Kuhl wäre das personalisierte Medizin. »Das Mammografie-Screening-Programm, das alle Frauen über einen Kamm schert, ist das Gegenteil davon.«
Wie geht es nun weiter? Eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung der Brustkrebs-Früherkennung sei anzustreben, sagt Klaus Kraywinkel vom Zentrum für Krebsregisterdaten am Berliner Robert- Koch-Institut. Allerdings solle vor Einführung neuer Methoden wie einer zusätzlichen Ultraschall-Untersuchung nachgewiesen sein, dass sie für Frauen auch bessere Ergebnisse bringt.
Dieser Nachweis sei aber nicht einfach. Eine Möglichkeit bestünde darin, unterschiedliche Programme in verschiedenen Regionen Deutschlands in einer Studie zu vergleichen. »Das ist natürlich sehr aufwendig und auch in der Öffentlichkeit nicht einfach zu vermitteln«, so Kraywinkel. Doch auf genau solchen Studien beruhe letztlich die Entscheidung für das laufende Screening-Programm in Deutschland. dpa/nd
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.