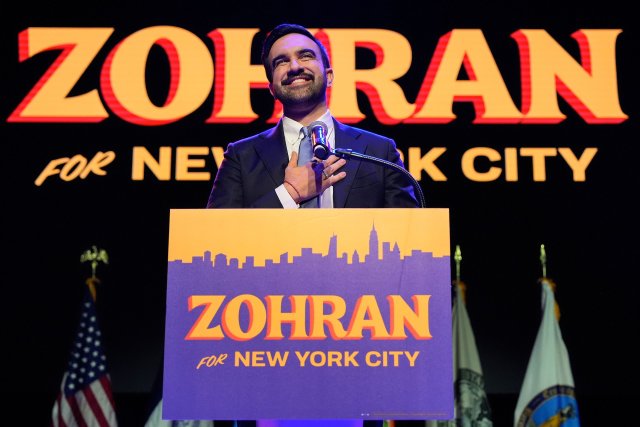- Politik
- Weimarer Nationalversammlung
Verunnüchterter Blick
Uwe Kalbe über das Gedenken an die Weimarer Nationalversammlung
Am Mittwoch bog sich die Weimarer Innenstadt förmlich unter dem politischen Gewicht der angereisten Amtsträger. Grund: Vor 100 Jahren, am 6. Februar 1919, trat eben hier erstmals das Nationalparlament zusammen, das ein halbes Jahr später, im Juli, die Weimarer Verfassung verabschiedete. Der Wert der heutigen Demokratie leite sich direkt aus diesem historischen Ereignis ab, so war es den weihevollen Reden immer wieder zu entnehmen. Vor 100 Jahren ging es freilich profaner zu. »Als ich um 10 ½ Uhr nach Hause gehen wollte, sind dort die Volksbeauftragten Ebert, Scheidemann, Noske erschienen und haben weitergekneipt ...«, berichtete der Abgeordnete Dr. Carl Petersen von der Deutschen Demokratischen Partei aus einer Weinstube. Der Senator aus Hamburg scheint daraufhin seinen Entschluss geändert zu haben und ebenfalls geblieben zu sein. Denn er fährt fort: Die Sitzung habe bis tief in die Nacht gedauert und die Volksbeauftragten hätten sich »stark verunnüchtert«.
Die Weinstube erhielt damals den Beinamen »Präsidentenkeller«, wie der Mitteldeutsche Rundfunk in dem Bericht hinzufügt, dem das Zitat entnommen ist. Was quasi symptomatisch ist für die Kluft zwischen Suff und seiner Verklärung, wenn es um Weimar geht. Stark verunnüchtert wirkt auch der Blick, mit dem heutige Begutachter auf das damalige Geschehen blicken, um darin eine geschichtliche Weihe zu finden, die sie ihrem eigenen politischen Handeln anheften können. Die als Geburtsstunde der heutigen Demokratie bewerteten Ereignisse fanden in Thüringen statt, weil die revolutionären Ereignisse die parlamentarische Elite aus Berlin vertrieben hatten - was zugleich die Distanz zumindest der überwiegenden Mehrheit des Parlaments gegenüber diesen Ereignissen dokumentiert. Die Revolution war es aber, die für die Beendigung des Krieges und die Abdankung des Kaisers gesorgt hatte. Wären die Geschicke damals allein Friedrich Ebert überlassen geblieben oder später dem Parlament, hätten wir ihn wohl immer noch, den Kaiser.
Nein, es gibt keinen Grund, die Vorzüge des Parlamentarismus oder der Grundrechte geringzuschätzen; was sollte dafür sprechen, eine Kopf-ab-Diktatur zu bevorzugen, wie es sie immer noch gibt auf dieser Welt? Das Maß an individueller rechtlicher Freiheit entscheidet - neben dem an ökonomischer Freiheit - maßgeblich über die Bewegungsfreiheit des Einzelnen. Vom Schutz der Grundrechte, die ihm hierzulande zugestanden sind, von der Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz profitieren auch Menschen, die in anderen Verhältnissen keine Chance hätten. Doch bedeutet das bekanntlich nicht, dass alle Menschen gleiche Chancen hätten.
Daran sollte gedacht werden, wenn es um das Gedenken an die Ursprünge der heutigen Demokratie geht. Dass sie Form für den Inhalt, eine Hülle ist - erstaunlich flexibel beim Moderieren der inneren Widersprüche -, aber eben Hülle für die realen Machtverhältnisse der Gesellschaft. Die Widersprüche, die diese Gesellschaft spalten, der unterschiedliche Einfluss, den Arm und Reich auf darin getroffene Entscheidungen haben, machen Demokratie und Autokratie einander ähnlicher, als Demokraten gern einräumen.
Die deutsche Demokratie ist auch geprägt vom Schrecken, der ihren Begründern nach 1945 in den Knochen saß. Und trotzdem ist es falsch zu glauben, die Demokratie sei das genaue Gegenstück zum Faschismus. Weimar hat den Faschismus nicht verhindert - nicht, weil der Parlamentarismus zu schwach war. Sondern weil er die Widersprüche nicht tilgen konnte, die die Gesellschaft spalteten. Die Nazis machten sich diese zunutze, und das Kapital signalisierte sein Wohlwollen, auch finanziell. Wer die Nazis fürchtet, muss sich um die Spaltung der Gesellschaft kümmern.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.