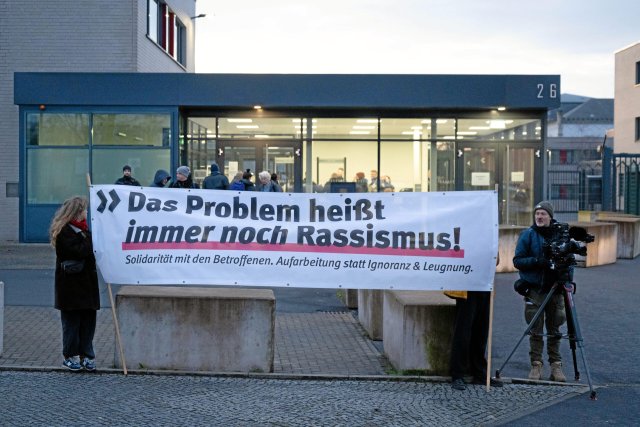- Politik
- Corona in Russland
Der unsichtbare Feind
Die Infektionszahlen steigen in Russland stetig, auch ohne Siegesparade zum 9. Mai. Erste Lockerungen gibt es trotzdem.
Unüberhörbarer Fluglärm erinnerte die Moskauerinnen und Moskauer Anfang der Woche daran, dass der 9. Mai, der Tag des Sieges, bevorsteht. Zwar wurde die Parade auf dem Roten Platz verschoben, nicht aber der in der Luft geplante Veranstaltungsteil, dessen Generalprobe lautstark über die Stadt hinwegfegte. Dazu ein festlicher Salut und die Aktion »Unsterbliches Regiment« - die aber nur im Internet. 75 Jahre nach dem Sieg über den deutschen Faschismus kämpft Russland derzeit gegen einen ganz anderen Feind. Erst vor wenigen Tagen hat es Deutschland und Frankreich bei den Covid-19-Infektionen eingeholt. Die Zahlen steigen so rasant, dass Russland mit 187 859 bekannten Fällen auf Platz fünf im weltweiten Vergleich geklettert ist. Wenn das Tempo nicht gedrosselt wird, lässt der größte Flächenstaat der Erde bald auch Großbritannien und Italien hinter sich.
Millionen Menschen, die wegen strikter Ausgangsbeschränkungen seit Wochen nicht mehr ihre Wohnungen verlassen oder bestenfalls den nächstgelegenen Supermarkt aufsuchen, erleben dieses Jahr ein visuelles Minimalprogramm zum Thema Krieg und hart erkämpftem Frieden. Im Vergleich zu sonst nimmt sich die Siegessymbolik im Straßenbild eher bescheiden aus. Heldinnen und Helden der Stunde sind das Krankenhauspersonal, das an vorderster Front gegen das unsichtbare Virus kämpft.
Seit Mittwoch lässt die anfängliche Disziplin in Moskau sichtbar nach. Nicht nur warmes Wetter treibt mehr Menschen auf die Straße, auch ihre Geduld wird zunehmend strapaziert, da das von hochrangigen Angehörigen des Staatsapparats gebetsmühlenartig angekündigte Plateau nicht kommen will. Aus dem zentralen Koordinationsstab dringen bedrohliche Infektionszahlen an die Öffentlichkeit kombiniert mit Erfolgsmeldungen. Offiziell liegt die Todesrate unter einem Prozent, getestet werde in vorbildlichem Ausmaß - all das ergibt ein verwirrendes Bild. Klar ist, dass es in der russischen Hauptstadt mit alltäglich Tausenden von Neuinfektionen vorerst keine Lockerungen für alle geben wird.
Ab der kommenden Woche gilt Masken- und Handschuhpflicht, während Industriebetriebe und Baustellen ihre Arbeit wieder aufnehmen dürfen. Andere müssen warten. Selbst Parks und Grünanlagen sind Tabuzonen. Je weiter entfernt von der Innenstadt, desto häufiger fällt auf, dass so mancher Laden wieder eröffnet, wenn die Räumlichkeiten den Kundenkontakt durch ein Fenster im Erdgeschoss ermöglichen. Nach Kiosken mit druckfrischen Zeitungen muss man dafür länger suchen. Eine Verkäuferin im Rentenalter hält nach wochenlangem Untätigsein mit ihrer Freude über ihren ersten Arbeitstag nicht zurück und äußert gleichzeitig die Sorge, wie sie ihren bescheidenen Tageslohn erwirtschaften soll.
Es ist ein vorsichtiges Ausloten, eine eigenmächtige Zurückeroberung minimaler Freiheiten, auf die viele zunächst ohne großes Murren verzichtet hatten, weil sie vom Staat entsprechende Gegenleistungen erwarteten. Aber der von Präsident Wladimir Putin annoncierte Urlaub bei Lohnausgleich entpuppte sich für etliche Bevölkerungsgruppen als erzwungene Auszeit ohne Einkommen. Selbstständige, Kleinunternehmer, nicht sozialversicherungspflichtig Angestellte und etliche mehr fallen durch das Raster in Aussicht gestellter Hilfsleistungen. Das sorgt für Missmut.
Dabei treffen Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen, die in vielen Regionen wesentlich ausgefeilter sind als in Moskau, angesichts realer Infektionsgefahren vielerorts auf Akzeptanz - allerdings nicht durchweg. Orthodox Gläubige hatten Gottesdienstverbote an Ostern häufig ignoriert, andere setzen sich über die Vorschrift hinweg, für Fahrten im öffentlichen Nahverkehr, Taxi oder im eigenen Wagen einen elektronischen Passierschein zu beantragen. Dafür muss die sich von der Meldeadresse oft unterscheidende faktische Wohnanschrift angegeben werden, wozu in der Hauptstadt nicht alle bereit sind. Überhaupt beäugen viele die von Bürgermeister Sergej Sobjanin forcierte Digitalisierung mit Skepsis.
Meist bleibt es bei passivem Widerstand oder Protestkundgebungen im Internet mit der Forderung nach Ausrufung des Notstandes, denn nur dann, so die Hoffnung, könne der Staat für Einkommensverluste haftbar gemacht werden. Die russische Führung präferiert indes eine schnelle Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität, ohne den Haushalt zu sehr zu belasten. Steigender Frust entlädt sich hauptsächlich gegen jene, die nicht nur zum erlaubten Einkaufen vor die Tür gehen, die Sicherheitsabstände nicht einhalten oder die sich über die verordnete Selbstisolation mokieren, weil sie angeblich nichts bringe.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.