- Politik
- Politische Bildung
15 Minuten für das Grundgesetz als Exportschlager
Modell der »Verfassungsviertelstunde« stößt in Sachsen auf Interesse

Die Bayern leben »in einer wundervollen Demokratie«, sagt Markus Söder. Allerdings habe diese auch Feinde, fügt Bayerns CSU-Ministerpräsident in einem Video auf Youtube hinzu; und man müsse aufpassen, dass man sich von diesen »nicht aus Faulheit, Trägheit oder Unwissenheit missbrauchen oder übertölpeln« lasse. Derlei Unwissenheit solle mit der »Verfassungsviertelstunde« ein neues Format der politischen Bildung entgegenwirken, das in Bayern seit einem Jahr praktiziert wird und auch andernorts auf Interesse stößt. Thüringen erprobt es im neuen Schuljahr an 20 Schulen. Und Sachsens Justizministerin Constanze Geiert (CDU) sagte jetzt, sie finde die Idee »tatsächlich fantastisch«. Dagegen ist Luise Neuhaus-Wartenberg, Bildungsexpertin der Linken im Landtag, skeptisch: »Eine Viertelstunde pro Woche wird es nicht richten.«
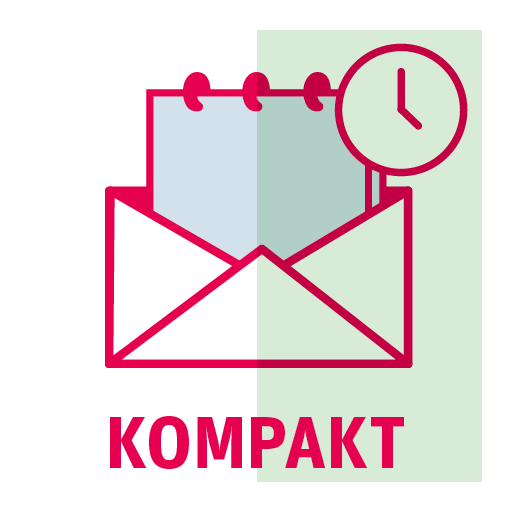
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Das bayerische Konzept sieht vor, dass sich Schüler im Freistaat 15 Minuten pro Woche »anhand praktischer Beispiele mit zentralen Werten des Grundgesetzes und der bayerischen Verfassung, insbesondere mit Grundrechten und den Werteprinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung« befassen. Das soll im Rahmen verschiedener Unterrichtsfächer geschehen. Seit Beginn des Schuljahres 2024/25 wird das Modell in ausgewählten Schularten und Jahrgangsstufen praktiziert. Wie es genau umgesetzt wird, bleibt den jeweiligen Schulen überlassen. Nach dem ersten Halbjahr äußerte sich Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) angetan: »Die unschätzbaren Werte der Menschenwürde, der Rechtsstaatlichkeit und der Toleranz werden tagtäglich eindrucksvoll an unseren Schulen vermittelt«, sagte sie der Nachrichtenagentur dpa.
Diese Euphorie wird nicht überall geteilt. Der Augsburger Bildungsforscher Klaus Zierer spricht zwar von einer »pfiffigen Idee«, aber die Qualität bei der Umsetzung gehe »in der Breite brutal auseinander«. GEW-Landeschefin Martina Borgendale sagte, es brauche »dringend mehr politische Bildung« an Bayerns Schulen. Diese müsse aber in der Stundentafel fest verankert und von ausgebildeten Sozialkundelehrern vermittelt werden. In Thüringen merkte die Bildungsgewerkschaft zum Auftakt des Schuljahres an, die Idee sei »besser als gar nichts«, viele praktische Fragen seien aber ungeklärt: »Wer macht mit welchem Fachwissen was und wie?« In der Politikdidaktik stehe zudem seit Jahren fest, dass ein Zeitrahmen von 15 Minuten »völlig unzureichend« sei. Die GEW fordert in Thüringen zwei Stunden Sozialkundeunterricht pro Woche in allen Schularten: »Das wäre tatsächlich ein substanzieller Beitrag zur Stärkung dieser Demokratie.«
»Die Kinder und Jugendlichen brauchen Mitbestimmungsmöglichkeiten. Das stärkt ihr Vertrauen in die Demokratie.«
Luise Neuhaus-Wartenberg Bildungspolitikerin Die Linke
Auch Neuhaus-Wartenberg hält eine Viertelstunde für zu kurz bemessen. Noch wichtiger sei aber, dass es nicht genüge, 15 Minuten lang über die Verfassung und deren Grundwerte nur zu reden. »Demokratiebildung muss praktisch gelebt werden«, sagte sie dem »nd« und wies darauf hin, dass Sachsens Schüler bisher bei der Lösung gravierender Probleme wie dem anhaltenden Lehrermangel, Unterrichtsausfall, einer fehlenden Medienbildung oder der Zunahme rechtsextremer Vorfälle nicht beteiligt werden. »Die Kinder und Jugendlichen brauchen Mitbestimmungsmöglichkeiten«, sagt Neuhaus-Wartenberg: »Das stärkt ihr Vertrauen in Demokratie.«
In der Chemnitzer »Freien Presse«, die zuerst über sächsische Reaktionen auf die bayerische Verfassungsviertelstunde berichtet hatte, verwies Roland Löffler, Chef der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen, auf das auch von ihm mit erarbeitete Handlungskonzept »W wie Werte«. Dieses schlage unter anderem einen »Klassenrat« vor, um auf aktuelle politische Fragen einzugehen. Das Handlungskonzept war 2024 von einem Expertenteam erarbeitet worden, um die Demokratiebildung in sächsischen Schulen zu stärken. »Demokratie muss gelernt werden«, sagte der damalige Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Manche Maßnahmen wurden sofort umgesetzt. Die Stärkung der Schülermitwirkung, hieß es indes, fließe in eine längerfristige Bildungsstrategie ein.
Offen ist im Zusammenhang mit der Verfassungsviertelstunde, inwieweit Lehrkräfte sich für die Aufgabe gewappnet sehen. Viele fühlen sich zunehmend verunsichert, weil Schüler immer öfter rechtsextreme Positionen vertreten und gleichzeitig etwa die AfD unter Verweis auf ein »Neutralitätsgebot« eine klare Positionierung von Lehrern zu unterbinden sucht. Bildungsforscher Zierer sieht kein Hindernis für eine klare Haltung gegen extremistische oder rassistische Positionen in der Schülerschaft: »Im Grunde müsste jeder Lehrer sich das von Anfang an auf die Fahne geschrieben haben.« Bei einem in Sachsen aktiven Demokratieverein aber heißt es, man stelle zunehmend fest, dass Lehrkräfte »nicht mehr ein noch aus wissen«, wenn sie von rechtsextremen Schülern argumentativ unter Druck gesetzt werden. »Unsere Angebote von außen sind angesichts dessen sehr willkommen«, sagte ein Mitarbeiter dem »nd«. Eine Viertelstunde wirkt angesichts dessen freilich viel zu kurz.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.







