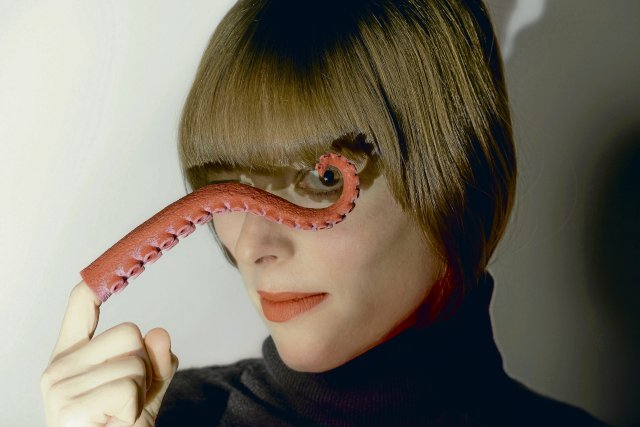- Kultur
- Marktplatz
Jäger sind Gejagte
Wie heiß ist der Preis? Entwurf zu einer Theorie des Sonderangebots
Waren werden oft nicht bloß mit einem Preis ausgeschrieben, sondern mit dessen zwei. Der Preis offenbart sich durch einen Vergleich mit sich selbst, indem er auf Ursprung und Berichtigung verweist. Durch diese augenscheinliche Korrektur werden Waren billiger angepriesen als ehedem. Der Komparativ drückt dabei stets nach unten. Es geht darum, günstiger zu kaufen, als die Konvention es gestatten würde. Der Vergleich macht die Kunden sicher. Auf den Preis reagieren sie wie Schildbürger auf Schilder.
Je eklatanter die Lücke zwischen Ausgangspreis und Endpreis, desto ist entschiedener das Kauf-Verlangen. Minus 30, minus 50, minus 70 Prozent! Der eliminierte Normpreis wirkt wie ein Eye-Catcher. Wir beurteilen dann die entsprechende Ware an ihrer Preisabweichung. »Sale«, schreit das Schild. Die Differenz der Preise, die Reduktion, erscheint dem Käufer geradezu kontrafaktisch als Gewinn. Er verliert nicht Geld, das er zu zahlen hat, sondern er gewinnt Geld, weil er nicht den Listenpreis entrichtet. Zwar ist die unmittelbare Motivation, einkaufen zu gehen, vom Bedürfnis nach bestimmten Lebensmitteln geprägt, doch die faktischen Einkäufe weichen meist vom konkreten Vorhaben ab.
Olga Hohmann versteht nicht, was Arbeit ist und versucht, es täglich herauszufinden. In ihrem ortlosen Office sitzend, erkundet sie ihre Biografie und amüsiert sich über die eigenen Neurosen. dasnd.de/hohmann
Eins kauft deswegen oft auch Dinge, die weder unmittelbar noch mengenmäßig, geschweige denn auf lange Sicht benötigt werden, getrieben von der Vorstellung, dass man so günstig nicht mehr zum Zug kommt. Immer wird etwas mitgenommen, das ursprünglich nicht auf der Agenda gestanden hat. Die Körbe geraten voller als die Wünsche. Wir meinen uns gar zu belohnen, auch wenn wir in einer solchen Situation mehr auslegen als vorgesehen. Obgleich die Ausgaben sich erhöhen, glauben wir, dass sie sich senken. Alles kostet weniger als es kostet, doch insgesamt kostet es mehr.
Reduzierte Waren erzeugen induzierte Käufer. Das Flanieren durch die Geschäfte ist kein profanes Beobachten und Schätzen von Gebrauchswerten und eine simple Rationalisierung ihrer Tauschwerte, es ist darüber hinaus ein sich verselbstständigendes Peepen von Preisen. Waren schreien nicht nur durch Reklame und Preis, sie kreieren zusätzliche Beachtung durch die heute flächendeckende Preisreduktion. Unterstellt wird, dass der unmittelbare Marktpreis unter dem eigentlichen Marktwert liegt. Ob das stimmt oder nicht, ist irrelevant, relevant ist, dass es so ankommt und dass die potenziellen Käufer dementsprechend funktionieren. Der Preis verrät nie, wes Ursprung er ist oder wessen Manöver er darstellt. Der Kunde ist wehrlos in seinem Handeln, mag er nun Bescheid wissen oder nicht. Ohne permanente, wenn auch wechselnde Sonderangebote kann heute kein Supermarkt mehr existieren. Die Frequenz ist steigend. An der Lebensmittelfront, an der wir täglich stehen, ist das am deutlichsten.
Markante Sonderangebote erzeugen des Öfteren wahre Ameisenaufläufe in den Geschäften. Jeder Auflauf erhöht die Aufmerksamkeit, ja er bestärkt den Eindruck, dass es dort etwas geschenkt oder äußerst billig abzuholen gibt. Diverse Shopping-Events werden gefilmt und medial vor- und auf-, zu- und nachbereitet, was den Effekt noch zusätzlich steigert. Käufer gleichen Lemmingen, die auf Zuruf angetrottet kommen. Sonderangebote ziehen sie in Windeseile an. Kaufhäuser und Märkte wirken wie Sirenen und die Anvisierten wie hilflose Opfer, die ob des Angebots »einfach zuschlagen müssen«. Der übermächtige Kunde ist der übermächtigte.
Käufer sind Opfer und Täter in einem. Ohne sie geht zwar nichts, aber sie laufen doch meist wie am Schnürchen. Bei der Hatz nach Sonderangeboten verkennen die Kunden sich ständig, sie wissen zwar nicht, was sie sind, aber sehr wohl, was sie zu tun haben. Jäger sind Gejagte. Sie meinen Jäger zu sein, die da Produkte via Sonderangebot gewinnen, während sie doch ebenso die von den Waren aufgescheuchte Herde sind, die als Horde Märkte überfällt, durchwühlt, aufmischt. In den Einkaufswägen und Warenkörben liegen keine Trophäen, sondern Waren, deren Wert realisiert wird. Schnäppchenjagd ist mentales wie reales Training für Kunden. Während etwa Yuppies nicht auf den Preis schauen müssen, müssen die Normalos immer auf ihre schmale Börse achten. Der kaprizierte Blick auf den Preis ist der ausschlaggebende Aspekt der Entscheidungen. It’s the opportunity, stupid! Waren verlangen von ihren Käufern ein schier angepasstes Verhalten. Und zwar pronto! Ihre Attraktivität liegt zuvorderst im Preis. Tauschwerte locken da mehr als Gebrauchswerte.
Neben den reduzierten gibt es noch die reduzierbaren Waren. Hier wird den Käufern selbst die Möglichkeit eingeräumt, Preisnachlässe vorzunehmen, indem sie Gutscheine einlösen können beziehungsweise für einen gesamten Einkauf bestimmte Prozentpunkte in Abzug bringen dürfen. Das erhöht nunmehr den Griff auf teure Waren respektive führt zu umfangreichen, auf jeden Fall überdimensionierten Einkäufen. Der Trugschluss besteht darin, dass vergünstigt auch als günstig erscheint. Nebenbei wird auf diverse Sicherheiten, auf Garantien, auf Rückgabe- und Umtauschrechte des Öfteren leichtfertig verzichtet.
Der Stimulus zum Kauf ist zwar vorhanden, aber er muss zusätzlich aufgeheizt werden. Preisnachlässe sind obligat geworden, sodass davon auszugehen ist, dass durch sie mehr Absatz erzielt und Gewinn gemacht werden kann als ohne sie. Ermäßigte Waren erheischen mehr Aufmerksamkeit als jene, die nicht verbilligt wurden. Sie spielen in einer eigenen Klasse. Kaufen ist dann nicht bloß die Möglichkeit, etwas zu bekommen, es ist die zeitlich begrenzte Chance, billig wegzukommen. Morgen schon könnte es zu spät sein. Der Absatz ist meist größer als der Vorsatz. Käufer wollen stets weniger, als sie kriegen. So stapelt sich Gerümpel in den Heimen und diverse Nahrungsmittel überschreiten das jeweilige Ablaufdatum. Es ist das »Haben-Müssen«, das da antreibt. Man hat zu haben. »Mehr!« lautet die Parole.
Digitalisierte Listen (Rechnungen, Bonuskarten, Zertifikate) sind zu Dokumenten der Kontrolle und Observation geworden. Keine Erledigung, die nicht ihren Weg in zahllose Verzeichnisse findet und an diverse Algorithmen angedockt wird. Kaum etwas wird so intensiv notiert und analysiert wie Marktverhalten und Kaufgewohnheiten, die eingespeist in die digitalen Systeme neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen und die Konkurrenz befeuern. »Die Welt als Warenhaus erweist sich als digitales Panoptikum mit einer Totalüberwachung«, schreibt Byung-Chul Han (in »Kapitalismus und Todestrieb« 2019).
Ein monetär diversifiziertes Warensortiment lässt die konditionierten Subjekte zum Erwerb antreten. Erst jenes konstituiert vollwertige Bürger. Der Appell verselbstständigt sich im Warensubjekt zur Befehlsausgabe. Er wird kanonisiert durch einen Gefangenenchor, der Käufer und Verkäufer auf allen Ebenen eingliedert. Für Verkäufer geht es nicht darum, einzelne Waren zu ihrem Wert zu verkaufen, sondern für Warenkontingente Durchschnittsprofite zu erzielen. Sie kalkulieren daher mit Sortimenten. Nicht einzelne Waren werden zu ihrem Wert verkauft, sondern bestimmte Warenkontingente über eine bestimmte Zeitdauer. Mengen werden auf Raum und Zeit bezogen und entsprechend disponiert. Berechnungen werden durch diese Mischkalkulationen immer komplexer, Prognosen schwieriger.
Sonderangebote und Aktionen, Preisnachlässe und Rabatte sind beständige Größen, das heißt, sie sind Ausnahmen, die zur Regel geworden sind. Es ist der »Werwolfsheißhunger« der Waren, von dem Karl Marx im ersten Band vom »Kapital« schreibt, der nach Verwertung am Markt und Entwertung in der Konsumtion schreit, der Kunden in Geschäfte und Netze treibt. Sie dienen und bedienen, halten sich aber gerade deswegen für autonom und selbstbestimmt. Etwas günstig erstanden zu haben, versetzt das bürgerliche Subjekt in Entzücken. Es gilt, die Umlaufzeit des Warenkapitals so kurz wie möglich zu halten. Stockungen und Staus sind Bedrohungen. Was da ist, muss raus, muss weg. Und zwar bald.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.