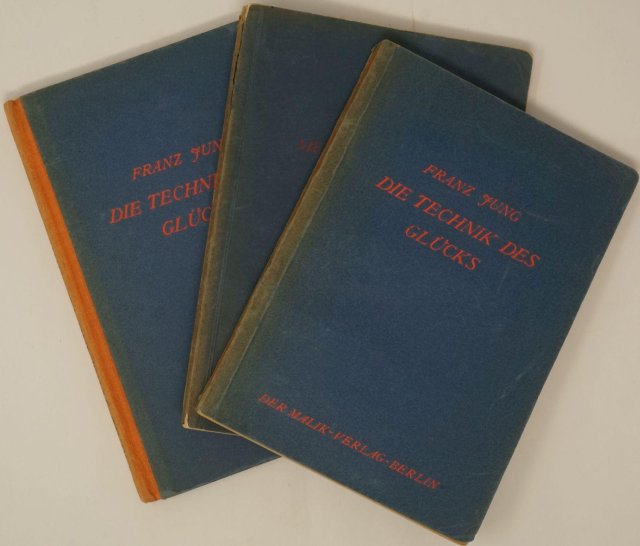- Kultur
- Amazon
St. Pauli-Serie »Luden«: Lidstrich als Kriegsbemalung
Die Serie »Luden« schafft etwas Besonderes: den Bandenkrieg der 80er Jahre auf St. Pauli zugleich brutal, intim und authentisch darzustellen
Wer Pferde besonders bedeutsam durch Nacht und Nebel sagenhafter Unterhaltung reiten lässt, wählt gerne Schimmel. Ob Götterbote oder Deichgraf, Kelten oder Araber, Gandalf oder Sir Lancelot: Mit weißem Gaul lässt es sich vielsagender antraben als mit dunklem. Das weiß auch der schöne Klaus, als er seine Party nicht per Rappe, gar Pony eröffnet. Nein, der Großstadtcowboy bringt auf dem Rücken eines edlen Schimmels »das Licht nach St. Liederlich«.
So beschreibt seine Freundin Jutta die Schlüsselszene der Amazon-Serie »Luden« und zeigt aus dem Off, wie weit Dichtung und Wahrheit selbst dann auseinanderklaffen, falls letztere verbrieft ist und erstere – in den Worten des Poeten Danger Dan – von der Kunstfreiheit gedeckt.
Zu Beginn des dritten Teils dieser sagenhaften Milieustudie also besiegelt die Rotlichtgröße Klaus Bakowsky den Aufstieg vom Kneipenkellner zum Kiezkönig, indem er sein Reeperbahn-Bordell blondgelockt auf weißem Pferd eröffnet. Welch ein Karrieresprung!
Keine drei Stunden zuvor nämlich war sein Haar straßenköterbraun und wurde im Klo einer versifften Kaschemme frisiert, auf dem der noch unschöne Klaus nach getaner Thekenschicht schlafen muss – bis sein Schicksal in Gestalt von Jutta Form annimmt. »Ich kann’s dir machen, deine Kriegsbemalung«, bietet er der Prostituierten nach einem Streit mit ihrem »Luden« an, wie St. Paulis Zuhälter heißen und zieht Juttas Lidstrich nach, »das hab’ ich mit meiner Tante auch immer gemacht, wenn die tatterig war.«
Mit dieser Intimität im Umfeld von Dreck und Elend ist nach zehn Minuten praktisch alles gesagt über ein sechsstündiges Stück Historytainment, das eine Vielzahl Fallstricke umkurven muss, aber nie ins Straucheln gerät. Nach »Hindafing« und »8 Tage« begibt Showrunner Rafael Parente sich abermals an den Rand bürgerlicher Normalität und macht daraus klischeeanfälliges Fernsehen, das ständig Vorurteile bedient und dennoch durchweg authentisch bleibt. Es ist ein kleines Fernsehwunder.
Denn, inszeniert von Laura Lackmann und Stefan Lukacs, zeichnen seine Drehbücher die frühen 1980er nach, als das Arbeiterviertel mit angrenzender Amüsiermeile nach politisch gewollter Vernachlässigung den Umbruch erlebte. Seit der »Hamburger Berg«, wie St. Pauli seinerzeit hieß, im 18. Jahrhundert als Ghetto für Abschaum aller Art galt, entwickelte die frühere Vorstadt ein Eigenleben von beispielloser, PR-Strategen behaupten fälschlich, weltbekannter Bildgewalt.
Anders als Kreuzberg oder Schwabing ist St. Pauli zwar bloß Mitteleuropäern ein Begriff. Die aber glauben es aus Dokus wie Tonio Kellners »Neonstaub«, Mehrteilern wie Dieter Wedels »König von St. Pauli« oder Kinofilmen wie Fatih Akins »Goldener Handschuh« genau zu kennen. Also auch das Märchen vom schönen Klaus, den der Hamburger Schauspieler Aaron Hilmer mit megalomanem Charme an seiner Vision arbeiten lässt: die hanseatische Version des New Yorker Partytempels »Studio 54«, ohne Andy Warhol zwar, aber mit »Liebe, Amore«.
Damit macht seine Figur zwar so viel Geld, dass sie im Lamborghini über die Reeperbahn brettert, »aber wir verkaufen das wie so’n Fischbrötchen von gestern«. Statt Straßenprostitution in Stundenhotels soll es daher ein Edelpuff sein, in den er wenige Serienminuten später unterm Jubel von Gästen und Boulevard einreitet. Leider zum Unwillen der Konkurrenz, »Chikago«-Chef Ringo Klemm (Dirk Böhling) etwa oder der »GMBH« des schönen Mischa (Stefan Konarske), mit dessen Bodyguard Beatle (Karsten Antonio Mielke) Klaus schon in der ersten Szene Stress hat.
Dem Bandenkrieg fallen von 1981 bis 1987 mindestens 15 Beteiligte zum Opfer. Da das für gefällige Unterhaltung trotz aller Action emotional arg dünn ist, dickt Parente sie um ein Melodram der fabelhaft Jeanette Hain als Mutter der verwaisten Manu (Lena Urzendowsky) an und garniert es mit sexueller Selbstbefreiung von Klaus’ Buchhalter Bernd (Noah Tinwa). Im Herzen der Erzählung aber steht die sensationell dreckig, ergo glaubwürdig dekorierte Subkultur maximal männlicher Alphatiere, denen das postheroische Zeitalter erst noch bevorsteht.
Archetypen wie dem jähzornigen Preisboxer Andy (Henning Flüsloh) zuzusehen, wie sie – beschleunigt vom Musical »Cats«, das 1986 bürgerliches Publikum auf die ruppige Reeperbahn lockt – ins Abseits geraten und umso brutaler zurückschlagen, ist deshalb das Alleinstellungsmerkmal der »Luden«. Zwischen Gewalt und Gentrifizierung, Sex und Aids, Pop und Koks ringen sie um Geld, Macht, Geltung, haben aber längst gegen die neue Generation noch viel grausamerer Kiezkönige verloren. Reichlich Stoff also für Fortsetzungen.
Verfügbar auf Amazon Prime.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.