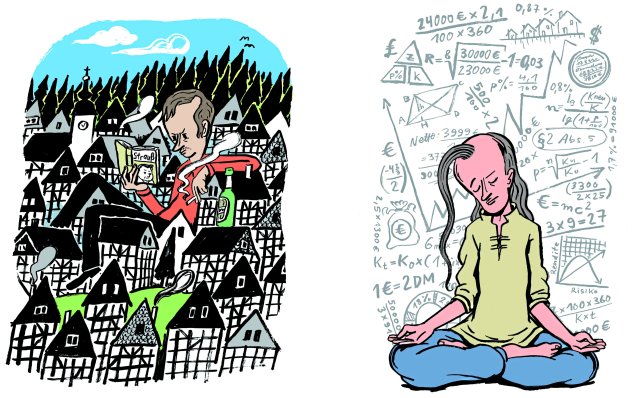- Kultur
- Geschichte des Stalinismus
Die vergessene Lebensgeschichte der Martha Naujoks
Ein Auszug aus dem 1. Band des Lesebuchs »Zwei Leben für die Befreiung«

Am 12. Juni 1937 fällen die »Internationale Kontrollkommission« (IKK) und die Parteiführung den Beschluss, Inge Karst »als nicht vertrauensvolles Element« aus der Partei auszuschließen. In dieser Zeit gibt es auch Überlegungen, sie aus der Sowjetunion in ein anderes Einsatzgebiet zu schicken. Diese Pläne werden offenbar wieder fallengelassen. Ihr selbst wird der Parteiausschluss ohne nähere Begründung und erst am 29. Juli mitgeteilt, weitere sechs Wochen später. Damit ist sie eine von etwa 900 Deutschen, die zwischen Herbst 1936 und Anfang 1938 aus der KPD ausgeschlossen werden.
Der Ausschluss, davon ist auszugehen, trifft Inge Karst wie ein Schlag. Entfernung aus der Partei und damit der Bewegung des Proletariats nach 17 Jahren hochaktiver, intensiver und riskanter Aktivität! Nur drei Tage nachdem sie von dem Ausschluss erfahren hat, wendet sie sich in einem handschriftlichen Schreiben an Wilhelm Pieck und bittet um ein Gespräch, »da ich in einer Situation stehe, wo ich nicht ein noch aus weiß«: »Es geht nicht nur darum, meine Parteiehre zu retten, sondern auch darum, dass man die Vorkommnisse in Hamburg klärt, um der ganzen Sache zu dienen und Klarheit nicht nur für mich, sondern auch für die Partei zu schaffen.«
Am Tag darauf erhebt Karst »mit einem ausführlichen Schreiben« bei der IKK und »den Genossen Dimitroff und Pieck« Einspruch gegen die Entscheidung, auf den sie allerdings keine Antwort erhält. In den folgenden Monaten unternimmt sie aufwendige Schritte, um die Partei davon zu überzeugen, dass ihr Ausschluss zu Unrecht erfolgt ist.
So sehr sich hier die Vorwürfe gegen sie selbst richten, sprechen andere Teile ihrer Korrespondenz mit den zuständigen Stellen der Partei auch eine überraschend selbstbewusste Sprache. Schon im August 1937 kritisiert sie klar und deutlich: »Kein Genosse der deutschen Partei hier in Moskau hat kameradschaftlich im Interesse der Untersuchung mit mir gesprochen. Das ist auch für mich persönlich einfach untragbar.« Sie fordert zudem – in einem Moment, in dem in ihrer Unterkunft und im gegenüberliegenden Hotel »Lux« ständig Genoss*innen verhaftet werden, darunter Freund*innen und Bekannte – ihr Recht im Bewusstsein ein, dass die Partei sich in ihrem Fall geirrt hat. Im Januar 1938 verfasst sie ein weiteres ihrer vielen Schreiben, in denen sie die IKK und die deutsche Parteispitze auffordert, ihren Fall neu zu untersuchen.
Darin beschuldigt sie durchaus offensiv Mitarbeiter der IKK, die Unterlagen ihres Falles »nicht genügend gründlich (...) und auch nicht objektiv (...)« geprüft zu haben. Sie habe zwar den Fehler begangen, die Mitgliedschaft ihrer Mutter im Leninbund nicht angegeben zu haben. Sie selbst habe aber niemals einer Gruppierung oder Fraktion gegen die Partei angehört. Ihre Haftentlassung im Oktober 1933 sei ebenso wenig verdächtig, da mit ihr auch die Mandatsträgerinnen Elise Augustat und Alice Wosikowski freigekommen seien. Sie schließt wieder in selbstbewusstem Ton einer Revolutionärin, der die Genoss*innen Unrecht angetan haben. Dabei setzt sie geschickt (oder verzweifelt?) Stalin als Gewährsmann für ihr Anliegen ein, und das in Worten, deren Klarheit erschütternd ist:
»Ich bedaure sehr, daß ich keine Abschrift der Ausschlußbegründung in den Händen habe und daher nicht auf weitere in derselben angegebene Punkte eingehen kann. Genossen! Seit meinem 17. Lebensjahr stehe ich in der Partei. Meine ganze Entwicklung, mein ganzes bewußtes Leben verlief in der aktiven Arbeit für die Partei im fortgesetzten politischen Kampfe. In meiner illegalen Arbeit 1921 in Halle, 1923, 1933 bis 1935 in Hamburg habe ich bewiesen, daß ich bereit bin, für die Partei alles, auch das letzte einzusetzen. Über diese 17jährige Parteitätigkeit wurde in einer halben Stunde das Urteil gefällt. Ihr versteht Genossen, welche qualvollen Monate ich seitdem durchlebte, ist doch ›für die ein- fachen Parteimitglieder das Verbleiben in der Partei oder der Ausschluß aus der Partei eine Frage von Leben und Tod‹ (Stalin).«
»Kein Genosse der deutschen Partei hier in Moskau hat kameradschaftlich im Interesse der Untersuchung mit mir gesprochen.«
Martha Naujoks, 1937
»Auch das letzte einzusetzen« in einer »Frage von Leben und Tod« – als Antwort auf diese dramatische, existenzielle Bitte erhält sie nur den Bescheid, dass man noch weitere Informationen einhole.
Die Entschlossenheit – auch in der Kritik an der Parteibürokratie! – und die Kraftanstrengung, die in diesen Zeilen deutlich werden, sind umso bemerkenswerter, als sie sich in diesen Monaten in einer unsicheren, sich immer mehr verschlechternden Situation befindet. Parteilos zu sein, und noch schlimmer: ehemalige Genossin, gefährdet auch ihre soziale Situation enorm. Denn damit geht die Beendigung ihrer Anstellung beim Redizdat einher, wodurch ihr Lebensunterhalt und ihre Unterkunft gefährdet sind.
Gleichzeitig kommen die Einschläge immer näher. Am 24. November 1937 informiert sie die deutsche Parteispitze von ihrer »Ungewissheit und dementsprechend materiellen Nöten« und lässt sie verzweifelt wissen: »Momentan stehe ich am Ende meiner Kraft«. Nur zwei Tage später wird ihre Moskauer Freundin Roberta Gropper als Mitglied einer angeblich »antisowjetischen Gruppierung« um das ehemalige ZK-Mitglied Heinz Neumann verhaftet. Ob die Verhaftung bei ihr eher einen Schrecken ob der gelungen Tarnung der konterrevolutionären Freundin oder ob des Ausmaßes der Repression auslöst, ist nicht zu sagen.
Jedenfalls sieht sie die Notwendigkeit, jeden Verdacht der Nähe zur Verhafteten auszuräumen und klärt die KPD-Vertretung bei der Komintern von sich aus über den Verbleib von Groppers Schreibmaschine in ihrem Besitz auf. Selbst eine geschenkte Schreibmaschine, zu dieser Zeit allerdings ein wichtiges politisches wie berufliches Werkzeug, konnte den Ruch der Parteifeindlichkeit auf ihre neue Besitzerin übertragen. Damit nicht genug. Vier Monate später, im April 1938, wird Käthe Schulz verhaftet, die wie Inge Karst im Hotel »Sojusnaja« wohnt, sogar mit ihr und Ruth Stolz im gleichen Zimmer. Sind die drei Genossinnen in diesem Moment alle zu Hause, hören das Klopfen und fragen sich, für wen der »Genosse vom NKWD« gekommen ist?
Obwohl die Verhaftungen ihr in diesen Tagen so dramatisch nahekommen, spricht sie von ihrem Parteiausschluss weiterhin deutlich als »Unrecht«. Es sei nicht nur ihre Lage »moralisch unerträglich«, sondern durch die folgende Entlassung aus der Komintern-Anstellung auch ihre »materielle Existenz in Frage gestellt«. Aus ihrem Zimmer Nr. 90 im Hotel »Sojusnaja« stellt sie Anfang April 1938 fest: »Ich glaube, Genossen, das Recht beanspruchen zu können, dass diesem für mich moralisch drückenden Zustand ein Ende bereitet wird und dass in meiner Lage raschestens volle Klarheit geschaffen wird.«
Zu diesem Zeitpunkt ist der dritte der Schauprozesse in der Stadt ihres Exils gerade abgeschlossen; im März 1938 waren Nikolai Bucharin und andere alte Bolschewiken unter dem Vorwurf, einen »Block der Rechten und Trotzkisten« gebildet zu haben, öffentlich gedemütigt und verurteilt und kurz darauf erschossen worden.
Vielleicht ist es schlicht Glück, dass nicht ihr Name auf die Befehle der NKWD- Beamten gesetzt war, sondern die von ihrer Freundin Roberta Gropper und ihrer Mitbewohnerin Käthe Schulz. Vielleicht ist das Vertrauen entscheidend, das einer der führenden Genossen der jungen Parteiarbeiterin entgegenbringt. An diesem Punkt herrscht wieder Dunkelheit. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass es für ihren Fall günstig ist, dass die beiden Personen, die ihren Ausschluss betrieben hatten – Władysław Stein-Krajewski und Grete Wilde – bereits seit etwa einem Jahr selbst dem stalinistischen Terror zum Opfer gefallen waren. Stein-Krajewski wurde im Mai 1937 in Haft genommen, im September erschossen; Grete Wilde, im Oktober 1937 verhaftet, stirbt vermutlich 1943 in einem Lager des Gulag-Systems.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.