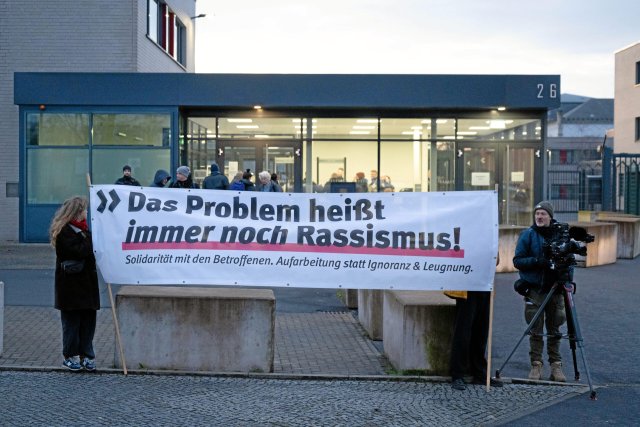- Politik
- Slowakei
Slowakische Rechtswende
Ministerpräsident Robert Fico strebt einen autoritären Staatsumbau an

Die exportorientierte Slowakei steckt in einer tiefen Krise. Insbesondere der wichtigste Wirtschaftszweig, die Automobilbranche, bereitet Probleme. Die Konzerne Volkswagen, Peugeot, Jaguar und Kia lassen Fahrzeuge im 5,5 Millionen Einwohner*innen zählenden Land fertigen, doch der – durch chinesische Konkurrenz, Absatzeinbrüche in den USA und die Zollpolitik der Trump-Regierung in den USA verursachte – Umbruch hat die Autoproduktion unter erheblichen Druck gesetzt. Die Folgen dieser Krise sind so gravierend, dass sie die Zukunft des sogenannten slowakischen Modells gefährden.
Im Schatten der Krise dieser Schlüsselbranche hat die Slowakei sich zu einem der führenden Rüstungsproduzenten in der EU gemausert. Allein im vergangenen Jahr verkaufte die slowakische Rüstungsindustrie Waffen im Wert von 1,15 Milliarden Euro. Bereits zu Zeiten der Tschechoslowakei waren in der Slowakei Rüstungsbetriebe entstanden, die Munition, Kriegstechnik und Militärfahrzeuge herstellten. Diese wurden in den vergangenen Jahren grundlegend modernisiert und infolgedessen immer unabhängiger von externen Zulieferungen aus Ländern wie China oder der Türkei.
Mit großem Interesse verfolgen die slowakischen Rüstungsproduzenten daher das Projekt ReArm Europe. Denn der im März dieses Jahres vorgestellte Plan ReArm Europe/Readiness 2030 der Europäischen Kommission sieht einen groß angelegten Ausbau der europäischen Rüstungsindustrie vor, den man für eine weitere Steigerung der Waffengeschäfte nutzen will. Bratislava hofft zudem auf ein Wachstum der Waffenverkäufe infolge des jüngsten Beschlusses der Nato, die Rüstungsausgaben auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu erhöhen.

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung unterhält mehr als zwei Dutzend Auslandsbüros auf allen Kontinenten. Im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit »nd« gibt es an dieser Stelle regelmäßig Berichte über Entwicklungen in den verschiedensten Regionen. Alle Texte auf: dasnd.de/rls
Dennoch dürfte es dem Land schwerfallen, die Verluste in der Automobilbranche durch gesteigerte Rüstungsproduktion aufzufangen. Hinzu kommt, dass die Regierung bislang keinen Plan für grundlegende wirtschaftliche Reformen vorgelegt hat, sondern sich aufs Durchwursteln festgelegt zu haben scheint. Im vergangenen Jahr lag das Haushaltsdefizit bei 5,3 Prozent des BIP; in der Eurozone sind eigentlich lediglich drei Prozent erlaubt. Die Regierung reagierte widersprüchlich: Einerseits beschloss sie finanzielle Konsolidierungsmaßnahmen, indem sie einige Steuern und Sozialversicherungsbeiträge erhöhte und Feiertage strich, andererseits beschloss sie gleichzeitig Energiepreishilfen und eine 13. Monatsrente für Ruheständler*innen.
Hufeisen-Regierung
Diese Widersprüchlichkeit resultiert auch aus der Eigenart der Regierungskoalition, die eine Art »Hufeisen« ist. Sie besteht aus der von Ministerpräsident Robert Fico geführten Slowakischen Sozialdemokratie (SMER), die über 41 Abgeordnete im Parlament verfügt, der 2020 von ihr abgespaltenen Sozialdemokratischen Partei (HLAS) mit 26 Abgeordneten, der der im vergangenen Jahr zum Staatspräsidenten gewählte Peter Pellegrini angehört, und der kleinen rechtsnationalen Slowakischen Nationalpartei (SNS), die acht Abgeordnete stellt. Zusammengehalten wird dieses heterogene Bündnis vom Ministerpräsidenten, dessen Partei Mitglied der Sozialistischen Internationale ist, aber national-populistisch auftritt und in der Gesellschaftspolitik sozialkonservative Positionen vertritt.
Für Fico ist es bereits die vierte Amtszeit, zuvor führte er bereits von 2006 bis 2010 und von 2012 bis 2018 unterschiedliche Koalitionen an. Sein Comeback als Regierungschef hatte viele Beobachter*innen überrascht, da er 2018 mit Schimpf und Schande aus dem Amt gejagt worden war. Der Anlass seines erzwungenen Rücktritts waren damals Massenproteste aufgrund der Ermordung des Journalisten Ján Kuciak und dessen Verlobter, Martina Kusnirova. Kuciak hatte zu den engen Verbindungen zwischen Politik und organisierter Kriminalität recherchiert.
»Besessen von Rache« sei Fico seitdem, sagt Peter Bardy, Chefredakteur des Portals »Aktuality« – so lautet auch der Titel seines aktuellen Bestsellers über den Ministerpräsidenten. Jüngst deckte »Aktuality« eine Affäre um eine Luxusvilla an der kroatischen Adriaküste auf, die über eine verschachtelte Eigentumskonstruktion mutmaßlich Ficos Besitztümern zuzuordnen ist – vermutlich ein weiterer Fall von massiver Korruption.
Fico sieht sich als von Feinden umzingeltes Opfer. Seit er im Mai 2024 ein Attentat nur knapp überlebte, hat sein Handeln tatsächlich Züge von Besessenheit angenommen: Angeblich haben die Opposition, unabhängige Medien, der Liberalismus, »LGBTQ-Ideologen« und die EU sich gegen ihn verschworen.
Blick nach Osten
Dieser Katalog von Gegnern korrespondiert mit Ficos Avancen gegenüber Moskau. Ähnlich wie der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán steht auch Fico für einen prorussischen Kurs. Bereits im Wahlkampf hatte er erklärt, unter seiner Führung werde die Slowakei »nicht einen Schuss Munition« an die Ukraine liefern, und bessere Beziehungen zu Moskau in Aussicht gestellt. SMER-Parteichef Andrej Danko geht in seinen prorussischen Statements sogar noch weiter – was auch daran liegen dürfte, das der kleinste Koalitionspartner, die SNS, angesichts ihrer schlechten Umfragewerte die Regierung vor sich hertreibt.
Besonders pointiert zum Ausdruck bringt diese Hinwendung zum Osten der Stellvertretende SMER-Vorsitzende Luboš Blaha, der zu Ficos engem Beraterkreis gehört. Er zeichnet in seinen Verlautbarungen ein klares Bild vom Westen als Ursprungsort aller Probleme: Der Westen sei böse, dränge zu Krieg und Nationalismus. Den Osten hingegen sieht er positiv, da dort angeblich Prinzipien wie Frieden und Freiheit herrschen.
Diesem ideologischen Kurswechsel in der slowakischen Außenpolitik lässt der Ministerpräsident Taten folgen. So reiste er im Mai dieses Jahres als einziger EU-Regierungschef zur Weltkriegssiegesfeier nach Moskau. Fico selbst bezeichnete seine Reise als äußerst erfolgreich. Er schrieb, sie habe »der Slowakei diplomatische Anerkennung auf höchster internationaler Ebene« gebracht und bestätigt, »dass die Slowaken in der Lage sind, auf eigenen Beinen zu stehen, ihre eigenen Meinungen zu vertreten, ihre Traditionen und die historische Wahrheit zu achten«. Wenig überraschend stieß diese optimistische Einschätzung bei den EU-Partnern auf Widerspruch.
Angesichts der Gespräche über das 18. Sanktionspaket der EU gegen die Russische Föderation gerieten beide Seiten im Juni in Konflikt. Das lag nicht zuletzt daran, dass die Energieversorgung der Slowakei weiterhin hochgradig abhängig ist von den Gaslieferungen des russischen Konzerns Gazprom. Fico stimmte dem Paket erst zu, nachdem die EU der Slowakei zugesichert hatte, einen Teil der EU-Finanzhilfen für Energiepreissubventionen einsetzen zu dürfen und dem Land bei möglichen Rechtsstreitigkeiten mit Gazprom zu helfen.
Ebenfalls im Juni ging der Ministerpräsident noch einen Schritt weiter. Angesichts des von der Nato verkündeten Ziels, fünf Prozent des BIP für Verteidigungsausgaben aufzuwenden, spekulierte er öffentlich über den Austritt der Slowakei aus dem Bündnis. Dem Land würde »Neutralität sehr guttun«. Diesen primär an die Wählerschaft von SMER und SNS gerichteten Worten widersprach Staatspräsident Pellegrini, der führende Politiker des dritten Koalitionspartners HLAS, postwendend: »Unsere Neutralität würde uns viel mehr kosten als unsere Mitgliedschaft in der Nato.«
»Damm gegen den Progressivismus«
Aber während Fico, der den Schulterschluss mit Orbán sucht, verbal für eine Hinwendung nach Moskau eintritt, bleibt sein Land einstweilen fest in die Strukturen von EU und Nato eingebunden. Deutlich mehr Spielraum aber besitzt der Ministerpräsident bei seinem Versuch des autoritären Staatsumbaus.
Nach einem Besuch in Usbekistan im Juni empfahl er das dortige Staatsmodell als Vorbild und kritisierte die »europäische Demokratie« als zu wenig effizient. So will er das politische System in der Slowakei umgestalten und etwa die Zahl der Parlamentsparteien mittels Sperrhürde begrenzen. Dahinter steckt eine einfache Rechnung: Je weniger Parteien ins Parlament kommen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass seine SMER nach der nächsten Wahl erneut die Regierung anführen wird. Dass hierfür eine Verfassungsänderung erforderlich ist, erschwert dieses Vorhaben. Dennoch ist die Opposition alarmiert.
Ebenfalls mit Verfassungsänderungen will Fico noch in diesem Jahr einen »Damm gegen den Progressivismus« errichten – was nachdrücklich bestätigt, dass die geläufige Etikettierung des Orbán-Freundes als »Linkspopulist« am Sachverhalt vorbeigeht. Geplant ist etwa, alle Geschlechter außer dem männlichen und weiblichen zu verbieten und das Adoptionsrecht zu ändern. Da die Oppositionsparteien ihrerseits ebenfalls Verfassungsänderungen vorgeschlagen haben, ist offen, wie die Entscheidung im Nationalrat ausfällt.
Überdies ist Fico seit Jahren ein Kritiker von Nichtregierungsorganisationen, deren Wirken er am liebsten nach dem Vorbild des russischen Gesetzes über »ausländische Agenten« begrenzen würde. Auch seine Ablehnung unabhängiger Journalist*innen, die er in aller Öffentlichkeit als »Idioten« bezeichnete, passt ins Bild. Bereits vor zwei Jahren ermöglichte ein Gesetz der Regierung eine stärkere Kontrolle der öffentlich-rechtlichen Medien. Ficos jüngste Idee ist die Einführung einer speziellen Journalistenkammer, die die Ausbildung von Journalist*innen kontrollieren soll.
Die potenziell folgenreichste Verfassungsänderung betrifft indes die angestrebte Vorrangstellung des slowakischen Rechts gegenüber dem europäischen Recht. Sollte diese Änderung beschlossen werden, könnten slowakische Bürger*innen sich beispielsweise nicht mehr an den Gerichtshof in Straßburg oder andere europäische Instanzen wenden – was den antidemokratischen Staatsumbau massiv begünstigen würde. Es ist jedoch fraglich, ob die Regierung diesen Schritt, der die Slowakei die Mitgliedschaft in der EU kosten könnte, tatsächlich umsetzt.
Schließlich will Fico auch das Strafrecht ändern und die Sonderstaatsanwaltschaft abschaffen, die sich mit hochrangigen Korruptionsdelikten – auch in seinem persönlichen Umfeld – befasst. Mit der Strafrechtsreform beauftragt hat er ausgerechnet den früheren Polizeipräsidenten Tibor Gaspar, der 2018 ebenfalls zurücktreten musste. Oppositionsführer Michal Simecka von der Progressiven Slowakei (PS) spricht von einem »Frontal-Angriff auf den Rechtsstaat«.
Fest steht, dass Ficos Rhetorik – und, was wichtiger ist, politische Praxis – sich gegenüber seinen früheren Amtszeiten erheblich verschärft hat. Der Slowakei steht ein äußerst ungemütlicher Herbst bevor.
Joanna Gwiazdecka leitet das Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Prag
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.