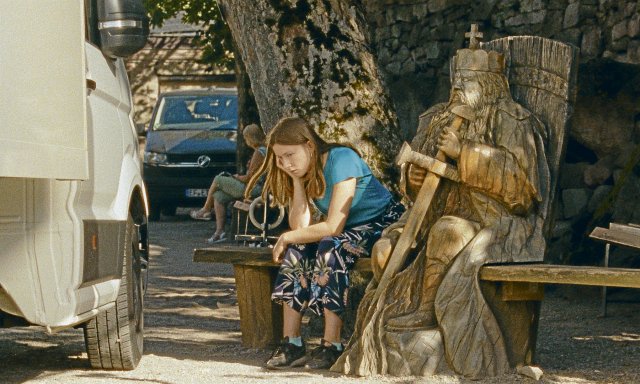- Kultur
- »Wednesday«
Algorithmusgeflüster bei Netflix
Bei Netflix werden die Dialoge immer schlechter. Damit sie besser viral gehen können

Mehr als 100 Serien-Neuheiten hatte Netflix für 2025 eingeplant – darunter die zweite Staffel seiner bisher erfolgreichsten Eigenproduktion, »Wednesday«. Nach drei Jahren hat das Warten also ein Ende, Jenna Ortega trägt wieder Zopf, die Tim-Burton-Produktion ist zurück.
Viele Fans sollten die Rückkehr von »Wednesday« sehnlichst erwartet haben – seit 2022 haben immerhin mehr als 250 Millionen Zuschauer die erste Staffel gestreamt. Nun ist das titelgebende Kult-Mitglied der Addams Family zurück und macht vor allem eine Sache deutlich: Seit 2022 hat sich einiges verändert. Auch bei Netflix.
Als die erste Staffel »Wednesday« im November vor drei Jahren online ging, war die Medienlandschaft noch eine andere. OpenAI hatte gerade ChatGPT veröffentlicht. Der Streik der Writers Guild of America – unter anderem gegen schrumpfende Writers Rooms und den uneingeschränkten Einsatz von KI – lag noch ein gutes halbes Jahr in der Zukunft. Und wenn man sich einen Netflix-Account mit vier ehemaligen Studienfreunden teilen wollte, die man seit 2016 nicht mehr gesehen hatte, dann war das vollkommen okay (jedenfalls in der viel gelebten Praxis).
Drei Jahre später ist es fast unmöglich, über Kunst zu sprechen, ohne dass Künstliche Intelligenz sich irgendwann ins Gespräch schleicht, die Writers Rooms sind immer noch klein – und Passwort-Sharing wird jetzt konsequent verfolgt. Streaming ist beliebter denn je, und die Gewinne von Plattformen wie Netflix wachsen und wachsen.
Und drei Jahre, ein geteiltes Premiere-Format und acht Episoden später ist jetzt auch klar: Nicht nur die Medienlandschaft hat sich verändert, sondern auch die daraus resultierenden Serien. Und was auch immer mit Wednesday Addams während des fiktionalen Sommers zwischen der ersten und zweiten Staffel (oder den sehr realen drei Jahren in der Produktion) geschehen ist – es ist vielleicht exemplarisch für die Richtung, die Serien anno 2025 einzuschlagen scheinen.
Zum Beispiel spricht die Titelheldin plötzlich ausschließlich in Punchlines, statt in einem funktionierenden Dialog. Das war 2022 noch nicht so. Zwei Folgen lang ist praktisch jeder Satz, der aus Jenna Ortegas Mund kommt, ein potenzielles Zitat, das in einem Tiktok-Video als Clip weiterverarbeitet werden kann.
Ein Schelm, wer da vermutet, dass es mittlerweile auch in den zusammengeschrumpften Netflix-Writers-Rooms angekommen ist, dass modernes Social-Media-Marketing größtenteils über Kurzclips auf Tiktok funktioniert – und man für Serien, die viral gehen sollen, auch entsprechende Zitate braucht, die ohne Probleme ihrem Kontext zweckentfremdet werden können.
Die One-Liner-Frequenz beruhigt sich zwar zumindest ein bisschen im Verlauf der Serie, aber dass Netflix’ am Algorithmus orientierte Marketingstrategien so auffällig durchscheinen, tut den Dialogen alles andere als gut. Oder um es in Wednesdays eigenen Worten zu sagen: »Nichts ist besser als ein mieser Wortwitz, der ein episches Gedicht beschmutzt.« Das könnte entweder das neue inoffizielle Motto des Streamers sein oder ein versteckter Hilferuf der Drehbuchautoren: Schnipp zweimal, wenn jemand gezwungen wurde, eine Tanzszene in die siebte Episode hineinzuschreiben, die potenziell viral gehen kann, nachdem das 2022 so gut funktioniert hat.
Dass Netflix Algorithmen analysiert, um möglichst erfolgreiche Serien zu fabrizieren, ist nichts Neues. Aber der Umfang scheint sich verändert zu haben. Nutzerdaten sind wichtiger denn je – und KI macht es möglich, diese in noch größerem Umfang für die Marktanalyse auszuschlachten. Auch wenn das, was dabei herauskommt, eben nicht unbedingt hohe Kunst ist – und in den meisten Fällen nicht einmal ein gutes Unterhaltungsformat. Und zumindest Letzteres war »Wednesday« 2022 immerhin.
»Langweilig, leicht verständlich, vor allem für Fans: Was hat der Netflix-Algorithmus mit unseren Filmen gemacht?«, titelte der »Guardian« in einem Artikel Ende August. »Und mit unseren Serien!«, möchte man da hinterherschreien. Die Schwächen der neuen Drehbücher sind ein Zeichen ihrer Zeit. Und das ist eine Zeit, die dominiert ist von Content, Algorithmen und KI.
Doch die Contentisierung des Serien-Marketings (und damit des Drehbuchs) ist nur ein Teil des Problems. Ein anderer – und vielleicht viel größerer – ist die Anpassung der Serien an die Aufmerksamkeitsspanne ihrer Zuschauer. Serien müssen, wie der »Guardian« es so schön formuliert hat, langweilig und vor allem leicht verständlich sein. Wieso? Weil Serien heute vor allem im Hintergrund laufen. Es gibt einfach zu viel Content, den man schauen kann. Also konsumiert man parallel.
Vorbei sind die Tage, an denen man sich am Donnerstagabend um 20.15 Uhr vor dem Fernseher versammelt und mit Spannung die lang ersehnte nächste Folge seiner wöchentlichen Serie geschaut hat. Da war niemand am Telefon – und schon gar nicht an irgendeinem Nokia-Tastenhandy. Mittlerweile sehen Fans Serien nicht nur häufig am Laptop (wo es praktisch unendlich viel Auswahl gibt, von der man sich ablenken lassen kann), sondern auch, während irgendetwas anderes passiert (zum Beispiel der Tiktok-Feed, wo, wenn alles gut geht, einem ja zumindest die viral gegangenen Zitate noch über den Weg laufen).
»Bin ich nur im Hintergrund an? Seid ihr am Handy?« aus Bo Burnhams Netflix-Comedy-Special von 2021, »Inside«, war offensichtlich nie nur eine rhetorische Frage, sondern etwas, das Netflix-Executives seit vier Jahren im Kopf herumgegeistert ist. Was dabei herauskommt, wenn man seine Zuschauer für unkonzentriert und ein bisschen langsam hält, auch dafür ist »Wednesday« ein gutes Beispiel.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Die zweite Staffel ist gespickt mit Dialogen, deren einziges Ziel zu sein scheint, die letzte Folge (oder die letzte Szene) noch einmal zusammenzufassen. Und obwohl jeder Schreibratgeber rät: »Show, don’t tell«, scheinen wir momentan in eine Ära zu schlittern, in der das immer mehr seine Gültigkeit verliert.
Wenn man es bis zur fünften Folge von »Wednesday« geschafft hat, wird man tatsächlich mit einer Szene konfrontiert, in der Enid, Wednesdays beste Freundin, dessen Roman-Skript aus einer Schublade zieht und mit Frontalblick in die Kamera sagt: »Wednesdays Roman!« Es ist fast, als würde man »Blue’s Clues« schauen. Was natürlich schlecht ist, da die Zielgruppe hier eigentlich nicht aus Fünfjährigen besteht.
Na und? Könnte man jetzt sagen. Wen juckt ein schlechtes Drehbuch? Haben wir nicht größere Probleme? Aber das Problem ist eben nicht, dass etwas schlecht geschrieben ist, sondern warum es schlecht geschrieben ist.
Es sollte uns Sorgen bereiten, wenn Kunst nur noch mit dem Augenmerk darauf betrachtet wird, wie viral sie gehen kann – oder dass Drehbücher bereits mit der Annahme geschrieben werden, dass sich eh niemand auf die daraus resultierenden Serien konzentrieren kann. Nicht einmal bei der lang ersehnten Fortsetzung der erfolgreichsten Serie des Streaming-Marktführers Netflix.
Social-Media-Marketing und die zunehmende Relevanz (und der zunehmende Umfang) von Algorithmen und Analysen verändern nicht nur, wie Kunst gemacht wird – sondern ultimativ auch die Medienkompetenz ihrer Konsumenten. Wir können uns nicht mehr konzentrieren, was zu Serien führt, die mit so vielen Erinnerungsstützen kommen, dass man sich auch gar nicht mehr konzentrieren will.
Die dritte Staffel von »Wednesday« ist jedenfalls bereits genehmigt. Und wer weiß, was wir vorfinden, wenn sie in ein paar Jahren über die Laptop-Screens und Smart-TVs flackert. Man kann nur hoffen, es ist eine Serie, die ihren Zuschauern wieder mehr zutraut.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.