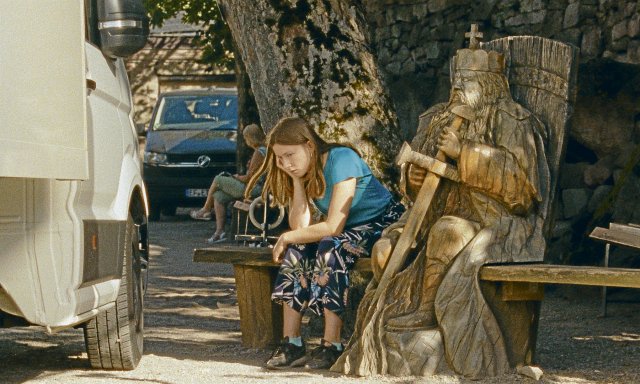- Kultur
- Theater der Unterdrückten
Harald Hahn: »Ressource für den Aktivismus«
Harald Hahn über das Theaterspielen als eine Methode, um Veränderungen anzustoßen

Sie bieten seit acht Jahren einen Workshop auf Hiddensee zum Thema Glück und Glücksverbote an. Und der richtet sich in erster Linie an politisch engagierte Menschen. Interessiert sich angesichts der allgemeinen Weltlage überhaupt noch jemand für das Glück?
Vielleicht anders aufgezäumt: Ich gehe davon aus, dass man politisch aktiv ist, weil man etwas verändern möchte. Gerade bei Menschen, die politisch aktiv sind, entsteht aber eine ganz große Einladung zum Frustriertsein. Wenn der politische Aktivismus nachhaltig sein soll, stellt sich die Frage: Wie schöpfe ich Kraft? In diesem Nachdenken bin ich auf die weitere Frage gekommen: Darf ich dann eigentlich glücklich sein? Das meine ich nicht als bürgerliche Kategorie, sondern als ein Glück, das auch das Leid der anderen einschließt in dieser Welt. Der Liedermacher Hans-Eckardt Wenzel hat ein Lied, da heißt es: Glück ist, wenn es für alle reicht. In diesem Sinn kann die Glücksfähigkeit eine Ressource sein für den politischen Aktivismus. Um die Verhältnisse zu verändern, brauche ich eine gewisse Resilienz und die Fähigkeit, mich an den Dingen zu erfreuen. Und die politischen Erfolge, die es ja auch gibt, zu sehen.
Harald Hahn, geboren 1966 in Aalen, machte nach einer Ausbildung zum Bäcker auf dem zweiten Bildungsweg Abitur und studierte Pädagogik. Er lebt als freiberuflicher Theatermacher und -pädagoge in Berlin und steht seit 2020 mit »Monolog mit meinem ›asozialen‹ Großvater. Ein Häftling in Buchenwald« auf der Bühne.
Sie arbeiten mit den Methoden des Theaters der Unterdrückten von Augusto Boal. Wie sind Sie überhaupt zu Boal gekommen?
Über einen Umweg. Ich habe in Bielefeld Erziehungswissenschaften studiert und habe mich mit freien Radios beschäftigt, also nicht kommerziellen Radios. Was ich da interessant fand, war diese Philosophie: Alle Menschen können Radio machen. Und bei Boal gilt: Alle Menschen können Theater machen. Man muss keine Schauspielschule besuchen. Und so habe ich Feuer gefangen. Ich habe an mehreren Workshops teilgenommen und dann angefangen, mit den Methoden des Theaters der Unterdrückten zu arbeiten. In Berlin-Kreuzberg hatte ich drei Jahre lang das Kieztheater beim Nachbarschaftshaus Urbanstraße. Dort haben wir politische Themen auf die Bühne gebracht.
Zu Ihren Projekten zählt auch das Legislative Theater. Was ist darunter zu verstehen?
Nachdem Boal nach seiner Flucht vor der Militärdiktatur aus dem Exil nach Brasilien zurückgekehrt war, hat er in Rio de Janeiro das Zentrum des Theaters der Unterdrückten aufgebaut. Damals hat ihn die Arbeiterpartei gefragt, ob er für das Stadtparlament von Rio kandidieren würde. Er wurde gewählt und hat in den Stadtteilen Theatergruppen gegründet, die dann Spielszenen entwickelt haben, mit Vorschlägen, um Gesetze zu verändern. Als Abgeordneter konnte er diese ins Parlament einbringen.
Das heißt, das war das historische Vorbild?
Ja. Deshalb habe ich mit meinem Kollegen Jens Clausen das erste Legislative Theater in Deutschland auf die Bühne gebracht. Aber anders als Boal habe ich ja kein politisches Mandat, deshalb haben wir das Legislative Theater in Berlin als ein Format entwickelt, wo wir Politikerinnen und Politiker mit Bürgern in den Dialog bringen.
Um welches Thema wird es dabei als Nächstes gehen?
2026 wird es ein Projekt zu Armutsbetroffenheit geben. Das war die Anfrage von Katja Kipping, die jetzt Geschäftsführerin beim Paritätischen Wohlfahrtsverband ist. Im September 2026 soll es in Berlin auf die Bühne kommen.
Wer fühlte sich bis jetzt von den Projekten angesprochen?
Sehr unterschiedlich. Beim Kieztheater war es eine bunte Mischung, sowohl vom Alter her als auch von der Migrationsgeschichte. Ich arbeite sehr gerne in nicht homogenen Projekten. Ich finde, man kann am meisten lernen, wenn man Menschen aus unterschiedlichen Milieus zusammenbringt. Und gerade in dieser Zeit, wo alle in ihren Blasen verharren, sind Diskussionsräume wichtig, wo man wirklich miteinander ins Gespräch kommt.
Können Sie eine typische Theaterübung beschreiben, die diesen Dialog herstellt?
Im Forumtheater wird zum Beispiel eine Szene gespielt, wo eine Spielfigur in der klassischen Sprache des Theaters der Unterdrückten nicht so handeln kann, wie sie möchte. Und das Besondere an dieser Methode ist, dass die Zuschauer auf die Bühne gehen können und die Spielfigur austauschen. Die Bühne wird demokratisiert, und so werden Veränderungsvorschläge in Szene gesetzt und danach auch diskutiert. Das nutze ich auch in meiner Arbeit, zum Beispiel im erwähnten Glücks-Workshop. Oder auch in Supervisionsprozessen. Es geht immer darum zu schauen: Wie kann ich anders handeln?
Neben theaterpädagogischen Projekten stehen Sie mit eigenen Stücken auf der Bühne.
Genau, seit fünf Jahren bin ich auf Tournee mit »Monolog mit meinem ›asozialen‹ Großvater«. Ich bin sehr froh, dass dieses Stück weiter angefragt wird. Das Stück macht mir sehr große Freude, weil ich damit ein eigenes Format für mich habe, also nicht theaterpädagogisch arbeite, sondern selber auf der Bühne bin. Die Geschichte handelt von meinem Großvater, der Häftling in Buchenwald war, als sogenannter Asozialer in Anführungszeichen. Diese verleugnete Opfergruppe, die sogenannten Asozialen und die sogenannten Berufsverbrecher, wurde erst 2020 vom Bundestag offiziell anerkannt.
Sie thematisieren in dem Stück auch die Scham der Familie, die die Geschichte so halb verschwiegen hat. Wussten Sie schon als Kind, dass Ihr Großvater in Buchenwald inhaftiert war?
In dem Stück gibt es eine kleine Szene, da erzähle ich meinem Großvater, dass ich bei den Kaffeerunden bei Tante Else war, und da kam es dann zur Sprache: Der Anton – das war der Name meines Großvaters –, der war ja auch im Lager. Da war ich ungefähr 13, als ich das zum ersten Mal wahrgenommen habe. Aber es wurde in der Familie wenig darüber gesprochen. Und irgendwann habe ich angefangen zu recherchieren über das Schicksal und das Lagerleben meines Großvaters.
Aber die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus hat mein Leben schon vorher geprägt. Ich war auch als Freiwilliger mit der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in den USA. Und ich habe Gedichte des jüdischen Dichters Theodor Kramer vertont und dazu das Buch »Lob der Verzweiflung« gemacht. Das heißt, ich habe mich immer wieder in Phasen auseinandergesetzt, aber erst sehr spät habe ich mich an die eigene Familiengeschichte getraut.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Wie war das für Ihre Familie, dass Sie das auf die Bühne gebracht haben?
Ich glaube, wenn meine Eltern noch gelebt hätten, hätte ich das nicht gemacht, weil ich sehr viel über die Familie in die Öffentlichkeit bringe. Meine Schwester hat das Stück in Aalen im Theater gesehen und fand es gut, dass es das Licht der Welt erblickt hat.
In der Schule in Aalen wurden Sie wegen Ihrer sozialen Herkunft stigmatisiert. Gab es auch Personen, die Sie später auf Ihrem Bildungsweg unterstützt haben?
Meine Biografie ist letztendlich ein Erfolg sozialdemokratischer Bildungsreformen. Ich habe auf dem Bielefelder Oberstufenkolleg Abitur gemacht. In Baden-Württemberg hätte ich das Abitur nicht geschafft, dafür auf dieser Alternativschule in Bielefeld, die angegliedert ist an die Universität. Da gab es auch die ersten Jahre keine Schulnoten. In dieser Schule wurde ich natürlich bestärkt.
Gibt es neben dem Monolog weitere aktuelle Bühnenprojekte?
Es gibt ein ganz spannendes Projekt bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, vom Monolog zum Dialog, die Ost-West-Dialoge, das im Januar in der Brotfabrik in Berlin-Weißensee auf der Bühne stehen wird. An einem Wochenende kommen Menschen aus West- und Ostdeutschland zusammen und erzählen sich gegenseitig ihre Geschichten über ihre Sozialisation. In diesem Workshop werden Monologe geschrieben. Einige werden wir partizipativ auf die Bühne bringen und darüber ins Gespräch kommen. So ähnlich wie beim Forumtheater, nur geht es nicht darum, die Szenen zu verändern. Ich finde es nach wie vor sehr wichtig, auch über dieses Ost-West-Thema zu sprechen.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.