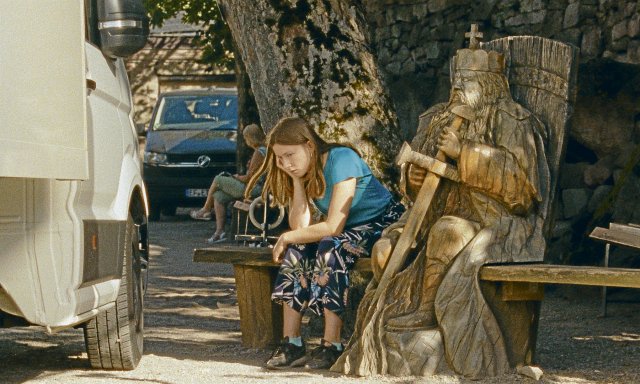- Kultur
- Nils Kumkar
Systemtheoretischer Populismus
Der Soziologe Nils Kumkar analysiert die »Polarisierung« der Gesellschaft – und landet selbst bei populistischer Politik statt Gesellschaftskritik

Der These kann kaum entkommen, wer die Wortmeldungen zum politischen Geschehen verfolgt: »Wir« – die Gesellschaft, die Politik – sind polarisiert. Polarisierung wird dabei selbstverständlich als ein Übel beklagt. Sie treibe die Menschen irgendwie künstlich auseinander und gefährdet, klar, den Zusammenhalt, das Vertrauen und schließlich »die Demokratie«. Dabei wollen wir doch eigentlich alle dasselbe, oder? Oder zumindest können wir uns, wenn wir jenseits hitziger Debatten gefragt werden, auf vieles einigen. Und doch knallt es in den politischen Diskussionen scheinbar ständig, Aufregerthemen reihen sich nahtlos aneinander. Wie kann das sein? Der Bremer Soziologe Nils Kumkar hat nun einen Beitrag zur Aufklärung über Polarisierung und – vor allem – das Jammern darüber vorgelegt.
Alles nur Einbildung?
Kumkars Buch ist eine Art Nachfolgestudie zur viel besprochenen Untersuchung »Triggerpunkte« von Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westheuser. Darin war 2023 festgestellt worden, dass die Einstellungen vieler Menschen in der BRD zu den meisten Themen keineswegs polarisiert sind. Ob es um Migration, um Klimaschutz oder um das Bürgergeld geht – nirgends finden sich in der Bevölkerung hart voneinander abgegrenzte Großgruppen. Es existiert also keine Polarisierung, so die Studie, wohl aber eine zunehmende Politisierung von bestimmten Reizthemen, den »Triggerpunkten« eben: Migration, Political Correctness, gendersensible Sprache, Tempolimits, Sozialbetrug etc.
Hier hakt Kumkar nach und fragt, warum dann aber an so vielen Stellen in dieser Gesellschaft offenbar eine Polarisierung wahrgenommen und sich darüber beklagt wird. Ist das alles Einbildung? Seine Antwort lautet: Ja und Nein. Die Polarisierung ist real, aber sie existiert nicht auf der Ebene persönlicher Überzeugungen, sondern als ein »kommunikatives Ordnungsmuster«. Dass wir uns im öffentlichen Streiten über politische Themen immer wieder in unversöhnliche Lager sortieren, ist laut Kumkar ein zentraler Bestandteil der modernen demokratischen Politik und ihrer massenmedialen Vermittlung. Das heißt, es passiert nicht einfach, weil die Streitenden böse Absichten verfolgen, nicht weil Algorithmen ihre Nachrichten filtern und auch nicht, weil sie von finsteren Kräften dazu verführt würden.
Integration durch Polarisierung
Den Zusammenhang einer notwendigen Polarisierung erklärt Kumkar systemtheoretisch: Die politischen Systeme in Nationalstaaten mit einer repräsentativen, demokratischen Ordnung haben demnach die Aufgabe, kollektiv bindende Entscheidungen zu erzeugen und durchzusetzen. Das könnten sie, weil ihr politisches System mit zwei grundlegenden Trennungen arbeite. Gemeint ist erstens die Spaltung zwischen Regierung und Opposition. Sie sorge zuverlässig dafür, dass beide Seiten immer Veränderungen der Gesellschaft und der Stimmung in der Bevölkerung genau im Blick behalten müssen, wollen sie nicht bei der nächsten Wahl den Kürzeren ziehen.
Zweitens stünden die Politiker*innen von Regierung und Opposition wiederum dem Volk als ausgeschlossenem Publikum gegenüber. Die verschiedenen Interessengruppen sitzen nicht selbst im Parlament, sondern werden repräsentiert. Dadurch stehe das politische System zumindest teilweise außerhalb der sozialen Konflikte der Gesellschaft. Diese nur lose Verbindung von realen Interessen und politischer Repräsentation ermögliche es dem politischen System, auch gegen die Interessen der Mehrheit Entscheidungen zu treffen und sie dennoch so darzustellen, als wären sie im Sinne aller.
Wer die liberale Demokratie retten will, muss ihr gefährlich werden, oder zumindest »gefährlich aussehen«.
Beide Trennungen würden also mehrheitsfähige Entscheidungen und Legitimität durch Verfahren erzeugen. Dass es immer eine Opposition gibt, bedeute, dass Dissens in die herrschende Politik integriert werden könne. Und genau dafür, so Kumkars Clou, brauche es Polarisierung: Nur wenn das Publikum es den streitenden Parteien abnehme, dass sie einen bedeutsamen, ernsthaften Streit austragen, identifiziere es sich mit einer Seite. Das gehe umso besser, wenn eine Partei sogar Fundamentalopposition betreibe. Polarisierung, also der zumindest inszenierte Konflikt mit zwei klaren Polen, hat demnach eine, so drückt Kumkar es systemtheoretisch aus, »Integrationsfunktion« für das politische System. Das zeigt sich etwa in der BRD in der steigenden Wahlbeteiligung, seit die AfD eine relevante politische Kraft geworden ist.
Das Schöne an dieser Argumentation ist, dass sie dem Gerede von »der liberalen Demokratie«, die durch Polarisierung bedroht sei, den Stecker zieht. Polarisierung gehört zur Demokratie und ist ein durchaus materialistisch zu bestimmendes Bauteil der Politik unter massenmedialen Bedingungen. Erhellend sind auch Kumkars Analysen der Polarisierung in politischen Diskussionen auf Social Media. Sie erklären, dass auch hier der Drang zur krassen Entgegensetzung aus der Struktur der Kommunikation folgt. In Kürze: Weil politische Diskussionen in Sozialen Medien vor einem potenziell unbegrenzten Publikum stattfinden, kranken sie an einer Explosion sozialer Komplexität. Verstehbar blieben sie nur, wenn sie sich auf einen schon bekannten zweipoligen Konflikt als kleinsten gemeinsamen Nenner beziehen.
Mehr Populismus wagen
Natürlich ist der praktische Hintergrund der ganzen Diskussion um Polarisierung heute der Aufstieg der populistischen radikalen Rechten. Hier offenbaren sich leider einige Schwächen der systemtheoretischen Herangehensweise. Schlüssig ist noch Kumkars These, dass der Rechtspopulismus wesentlich von einer offen betriebenen Polarisierungsstrategie lebt. Den beschriebenen Widerspruch zwischen Politiker*innen und Publikum nutzten AfD und Co., um den weitverbreiteten Hass auf die politischen Eliten zu inszenieren. Ihre Fundamentalopposition versuche nicht, irgendwelche Interessen zu vertreten, sondern inszeniert mit rebellischem Gestus spektakulär das Ausgeschlossensein aus der Politik.
Damit besetzten sie einen Pol in der Polarisierungsordnung liberaler Demokratien, der seit dem Zusammenbruch des Realsozialismus brach lag. Dagegen, so Kumkar, hilft nur, den Rechten diesen Pol mit einer anderen Polarisierung streitig zu machen. Gegen die rechtsradikale Polarisierung komme nur linke Gegenpolarisierung an. Wer die liberale Demokratie retten wolle, müsse ihr gefährlich werden, zumindest für die bestehende Ordnung »gefährlich aussehen«. Das mag Verfassungspatriot*innen überzeugen, schmeckt für Linke aber natürlich etwas fad. Sollen Fundamentalopposition und revolutionäre Agitation nur inszeniert werden, um den Vormarsch des Rechtspopulismus einzugrenzen und die bestehende Ordnung zu stützen? Am Ende seines Buches suggeriert Kumkar, dass mit so einer Strategie »ganz vielleicht« auch der Weg zu anderen Verhältnissen beschritten werden könnte. Dafür tut er so, als würde seine Analyse an die des marxistischen Staatskritikers Johannes Agnoli anschließen. Das aber geht vorne und hinten nicht auf, denn Kumkar kritisiert weder Staat noch Kapital.
Es wäre daher näher liegender gewesen, sich auf Chantal Mouffe oder Ernesto Laclau zu stützen und das Ganze wie gehabt »linken Populismus« zu nennen. Denn das ist es, was Kumkar vorschlägt: den immanenten Widerspruch von Politiker*innen und Publikum und den Hass auf das politische Personal durch radikale Elitenschelte von links zu politisieren, um den Rechten das Wasser abzugraben. Nur: Diese Strategie, die auf eine Personalisierung gesellschaftlicher Verhältnisse und die Wiederherstellung vermeintlicher Normalität setzt (»Die Eliten sind schuld!«, »Früher war alles besser!«) organisiert niemanden, sondern mobilisiert bloß Wähler*innen. Das gesteht zwar auch Kumkar ein. Wie aber der Übergang vom Linkspopulismus zu wirklicher Bewegung gelingen soll, bleibt unklar. Sicher weiß Kumkar auch, dass Agnoli 1967 gegen die Involution der Demokratie nicht einfach ein »anderes Nein«, sondern gerade das »organisierte Nein« zu Herrschaft und Kapitalverhältnis stellte. Das aber lässt sich nicht mehr systemtheoretisch begründen, sondern nur mit einer emanzipatorischen Gesellschaftskritik, die auf eine andere, umfassende Demokratie zielt.
Nils Kumkar: Polarisierung. Über die Ordnung der Politik. Suhrkamp 2025, 290 S., br., 18 €.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.