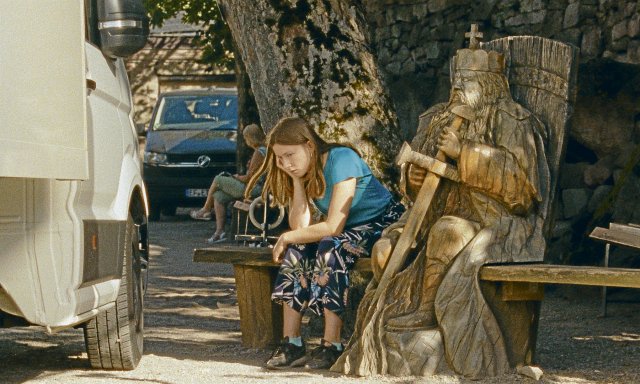- Kultur
- Ketty Guttmann
Kämpferische Huren
Raimund Dehmlow und Thomas Iffert würdigen Ketty Guttmann, Vorkämpferin für Frauenrechte

Ketty Guttmann war vieles, doch wenig ist über sie bekannt. Den meisten Kennern der Hamburgischen Stadtgeschichte dürfte sie als Herausgeberin des »Prangers«, des ersten Kampfblattes der Hamburger »Kontrollmädchen«, also der Sexarbeiterinnen von St. Pauli und St. Georg bekannt sein. Doch war sie auch eine Vorkämpferin der Frauenbewegung, die trotz Größen wie Clara Zetkin und Rosa Luxemburg immer zumindest eine zweitrangige Rolle in der deutschen Arbeiterbewegung spielte. Dann war sie eine unermüdliche Organisatorin der Kommunistischen Partei in Hamburg. Mutig agitierte sie unter den Hafen- und Werftarbeitern. Gegen ihre Partei ging sie in die innerlinke Opposition, als diese einen für ihren Geschmack allzu russlandtreuen Kurs einschlug.
Nicht einmal ein Foto von ihr konnten die Herausgeber der nun erschienenen biografischen Miniatur »Ketty Guttmann oder: Eine Todfeindin der Autoritäten« finden. Raimund Dehmlow und Thomas Iffert ist es dennoch gelungen, eine vergessene Figur der deutschen Arbeitergeschichte wieder lebendig werden zu lassen und mit ihr Einblick in die Kämpfe einer Epoche zu gewähren, die heute allzu schnell der Romantisierung, der Vereinfachung oder gleich ganz dem Vergessen überantwortet wird. »Mir brauchte man in meinem ganzen Leben nur einen Befehl zu geben und man hatte mich zur Todfeindin«, dieses Zitat stellen Dehmlow und Iffert ihrer einleitenden Kurzbiografie voran, und hierin scheint sich das ganze Programm von Guttmanns Idee eines emanzipativen Kommunismus zu spiegeln.
1883 in Hessen als Tochter eines Buchdruckers geboren, begann sie bereits ab 1899 zu arbeiten. 1904 wurde sie Mitglied der SPD und ging nach Polen, wo sie Zeugin eines Aufstandes polnischer Arbeiter gegen das russische Zarenreich wurde. Aus dieser Zeit stammt der erste Originaltext, der in diesen Band aufgenommen ist: eine poetische Beschreibung des Elends, in dem die Arbeiterinnen und Arbeiter von Łódź lebten. Von hier ging es nach Berlin, wo sie für Clara Zetkins Zeitschrift »Die Gleichheit« schrieb.
Mit ihrem Mann Felix Guttmann schließlich zog sie nach Hamburg, wo sie die Zeitschrift »Der Pranger« gründete und als eine der ersten Aktivistinnen versuchte, Sexarbeiterinnen zu organisieren, um gemeinsam gegen Ausbeutung und Stigmatisierung zu kämpfen. Hier trat sie – unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs und der Bewilligung der Kriegskredite durch ihre eigene Partei in die KPD eingetreten – auch als Agitatorin auf: Maßgeblich war sie an der als »Märzaktion« in die Geschichte eingegangenen Betriebsbesetzung der Vulkan-Werft am 23. März 1921 beteiligt, bei der vier Arbeiter von der paramilitärisch organisierten Sicherheitspolizei ermordet wurden. Später kritisierte sie ihre eigene Rolle bei diesen Ereignissen. Diese Ereignisse mögen es auch gewesen sein, die sie ab Mitte der 20er Jahre zu immer stärkerer Kritik an der eigenen Parteilinie führten.
Zwei Texte aus dieser Zeit, die ein Schlaglicht auf die innerlinken Debatten der Weimarer Republik werfen, sind in diesem Band abgedruckt: Eine Broschüre mit dem programmatischen Titel »Los von Moskau!« aus dem Jahr 1924 und eine Arbeit mit dem heute kryptisch anmutenden Titel »Materialien zur Arbeit: ›Béla-Kunismus‹« aus dem Jahr 1929. Dies ist, neben der biografischen Einleitung, die uns überhaupt erst wieder mit der Person Ketty Guttmann bekannt macht, die große Stärke des vorliegenden Bandes: Zusammen mit dem 1911 in Zetkins »Gleichheit« erschienenen Text über Łódź und ihren Texten aus dem »Pranger« der frühen 20er Jahre bietet er einen Querschnitt durch diese Debatten, den man anderenorts gegenwärtig vergeblich sucht.
Insbesondere die kurzen Artikel aus dem »Pranger« geben Einblick in eine Debatte, die heute allzu leichtfertig auf den einfachen Widerspruch zwischen prüde-protofaschistischen Sittenwächtern und freudianisch-fanatisierten Befreiern der Sexualmoral reduziert wird. Einerseits zeigen die Texte Guttmanns ein feines Gespür für die Dialektik von ökonomischer Ausbeutung und gesellschaftlicher Ächtung; andererseits müssen die homophoben Untertöne, mit denen sie die dem ökonomischen System der Prostitution zugrunde liegende bürgerliche Doppelmoral kritisiert, die heutige Leserin irritieren.
Ebenso muss es aus heutiger Sicht verwundern, dass sich Guttmanns Kritik der autoritären Tendenzen der kommunistischen Internationalen ihrer Zeit ausgerechnet am 1938 in Moskau hingerichteten Ungarn Béla Kun abarbeitet. Es ist jedoch das große Verdienst dieses Bandes, diese Widersprüche nicht zu verdecken, sondern auszustellen. Er zeigt Guttmanns Arbeiten nicht als bloße Dokumente einer vergangenen Zeit, die bestenfalls für den Lokalhistoriker taugen, sondern als Zeugnisse einer Kritik im Handgemenge.
Raimund Dehmlow/Thomas Iffert (Hg.): Ketty Guttmann oder: Eine Todfeindin der Autoritäten. Karl Dietz, 182 S., br., 14 €.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.