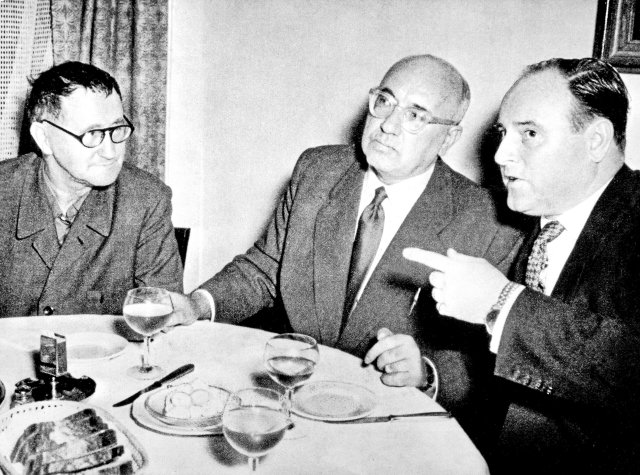- Kultur
- Georg Seeßlen
Elon allein im Kinderzimmer
Georg Seeßlen hat sich Elon Musk auf die Psychocouch gelegt und beäugt eine irrwitzige gesellschaftliche Realität

Für mich war die Übernahme von Twitter durch Elon Musk schon eine eindeutige und gleichsam symbolhafte Kampfansage: Das niedliche kleine blaue Vögelschen verschwand, getilgt durch ein dickes schwarzes X, ausgeext, ausgelöscht, ausgemerzt. Und quasi über Nacht wurde auf dieser Plattform auch der Ton rauer, aggressiv, hasserfüllt, hetzend, diffamierend und denunzierend. Ich stieg aus. Da wollte ich nicht mehr sein, auf dem digitalen Jahrmarkt der Eitelkeiten und Einflussnahmen eines der reichsten, mächtigsten und dümmsten Menschen der Welt. Gar dessen Vermögen noch vermehren? Gleich mir taten es viele. Doch was nützt ein solcher individueller Widerstandsakt? Weit über 200 Millionen Follower zählt Musks persönlicher Account. Er schaltet und waltet ungehemmt und ungebremst, vernebelt Hirne, vergreist Menschen intellektuell. Von keiner Instanz kontrolliert oder zur Rechenschaft gezogen. Nach einem US-amerikanischen Gesetz wird eine Internetplattform nicht in einer gesellschaftlichen Verantwortung gesehen, wie sie der Presse abverlangt wird.
Nicht nur, dass Musk ein Narzisst sondergleichen ist, der wohl größte der Weltgeschichte, der selbst Nero, den jämmerlichen Dichter und Brandstifter Roms, wie auch Kaiser Caligula in den Schatten stellt, der sein Pferd zum Senator ernannt hatte. Ein Irrer par excellence. Und das Schlimmste ist, dass er eine unheilvolle Macht ausübt, weltweit. Über die leider viel zu viele hinwegzusehen bereit sind.
Vielleicht kann diese Biografie aufrütteln, aufwecken? Georg Seeßlen hat sich der unangenehmen, unerquicklichen, unappetitlichen und doch so notwendigen Aufgabe unterzogen, sich in das Leben und die Welt des Elon Musk zu vertiefen. Dem in Kaufbeuren lebende Kulturkritiker gelingt dies mit analytischem, vor allem psychologischem Scharfsinn, sowie mit profunder Kenntnis polit-ökonomischer Umbruchsprozesse jüngster Zeit. Ob seine Studie den Tycoon vom Sockel zu stürzen vermag, darf bezweifelt werden, aber zumindest könnte sie für einige Risse sorgen.
Zwar regt sich gelegentlich hier und dort Widerstand gegen den Möchtegern-Weltbeherrscher und tatsächlich einflussreichen politischen Influencer. So hat Brasilien entschieden, dass sich X an geltendes Presserecht zu halten und die Verbreitung von Falschmeldungen zu unterlassen habe, ansonsten würde man den Dienst im eigenen Lande abschalten. Auch Frankreich, Großbritannien und Deutschland versuchen sich gegen Hate Mails und Fake News mit Gesetzen und Verordnungen zur Wehr zu setzen, vermerkt Seeßlen. Von einer wirkungsvollen Einhegung der digitalen Umtriebe von Musk ist man jedoch weit entfernt. Seeßlen erinnert an dessen massive Einmischung in den Bundestagswahlkampf Anfang dieses Jahres, an das »bizarre Interview«, mit der er der AfD-Kandidatin Alice Weidel auch ein internationales Publikum verschaffte. »45 Millionen Mal wurde dieses Interview innerhalb von nur 24 Stunden abgerufen; kein deutsches Medium erreicht auch nur annähernd eine solche Reichweite.«
Der erste Satz in dieser Biografie irritiert zunächst einmal: »Elon Musk ist, ob wir’s glauben oder nicht, erst einmal ein Mensch, einer wie du und ich.« Na klar: »Er wurde geboren, genährt und erzogen, er erlebt Krankheiten und andere Schmerzen, und irgendwann wird auch er sterben.« Seeßlen schiebt sodann hinterher: »Aber Elon Musk ist eben auch noch etwas ganz anderes als ein Mensch, der, mit welchen Mitteln auch immer, zu enormem Reichtum und damit auch zu Macht gekommen ist. Elon Musk ist ein Unternehmer und ein Produzent von medialen Botschaften, ein Selbstdarsteller und Repräsentant, ein Idol und ein Hass-Objekt, eine öffentliche Erscheinung, eine Pop-Ikone, am Ende schließlich: ein Politiker im Zentrum der Macht, ein ›Herrscher‹.« Und einem solchen muss man auf die Finger schauen, da gilt nicht das Recht auf Privatheit. Jedenfalls nicht in einer Demokratie, die freilich Musk wie sein Freund im Geiste, Donald Trump, als störend, lästig empfinden, weshalb sie sich emsig mühen, diese abzubauen, im nationalen Rahmen wie im digitalen Raum durchaus schon mit einigem Erfolg.
Wie konnte es zur Entstehung des sogenannten Tech-Faschismus aus der einst so liberalen, diversen und progressiv erscheinenden Kultur von Silicon Valley kommen, fragt sich Seeßlen. Wie konnten »Typen zum Anfassen«, anfangs sympathisch daherkommende Nerds in Schlabber-T-Shirt und Turnschuhen, die Comics lieben und Burger bevorzugen, zu aggressiven, rücksichtslosen Unternehmern mit Weltmachtallüren werden? Dies trifft ja auch auf andere Tech-Milliardäre zu, wenngleich nicht in dieser krassen Ausartung wie bei Musk. »Zu den Konstanten unserer Bilder von den Herrschenden gehört es, den unbedingten Willen zur Macht auf einen biografischen Defekt zurückzuführen, auf eine tiefe Kränkung, einen Mangel, einen ungelösten Widerspruch. Dafür haben wir fast schon wieder eine eigene Mythologie der ›kranken Herrscher‹ entfaltet.« Die tatsächlich jahrzehntelang in (West-)Deutschland zu erleben war, zur Erklärung des »Phänomens Hitler«, exakter: zur Entschuldung eines tief mitschuldigen Volkes.
Wie ist Elon Musk der Mensch geworden, der er heute ist? Um diese Frage zu beantworten, durchleuchtet Seeßlen freilich auch dessen Kindheit im Südafrika der Apartheid. Unter einem gewalttätigen Vater und der Scheidung der Eltern hatten und haben auch andere Kinder weltweit zu leiden, ohne ein »Musk« zu werden. Prügel in der Schule bezogen andere ebenso. Frühe Faszination für die sich rasant entwickelnde Computertechnik zeigten und zeigen Heranwachsende allerorten, so ihnen dies materiell möglich war und ist. Von Südafrika über Kanada in die USA einreisend, gründete Elon Musk 1995 mit seinem Bruder sein erstes Internetunternehmen, Global Link. Er surfte auf der Welle der New Economy. Dass ihn Innovationsgeist auszeichnete, kann man ihm nicht absprechen. Seeßlen rekonstruiert die Anfänge des Musk-Imperiums und erzählt in den folgenden Kapiteln die Tesla- und die Space X-Story sowie, wie sich die Übernahme von Twitter vollzog. Risikofreudigkeit und Wagemut sind für Musk bisher immer gut ausgegangen. Aber Seeßlen warnt, dass »das Imperium des reichsten Mannes der Welt wie ein Kartenhaus zusammenbrechen könnte«. Nanu, der deutsche Feuilletonist wird doch nicht etwa Mitleid mit diesem verrückten »Ami« hegen? Natürlich nicht. Aber »wir« alle wären betroffen, wenn dies geschieht. So unterbreitet Seeßlen im letzten Teil seines Buches Vorschläge, wie die Politik im Fall der Fälle zu reagieren hätte. Interessant auch seine Diagnose bezüglich Musk: »Das schon fast hysterische Zelebrieren von Herrschaft ist vielleicht das größte Zeichen von Schwäche.«
Eingehend befasst sich der Biograf mit dem »Menschenbild« des Mannes, »der seinen eigenen sozialen Sadismus genießt und scheinbar ohne Skrupel Existenzen, Hoffnungen und Familien vernichtet, für den ›großen Plan‹, den Herrschende immer zu ihrer Rechtfertigung heranziehen«. Als Musks »großen Plan« macht Seeßlen die »Herrschaft einer rassistischen, sexistischen und klassizistischen Tech-Elite« aus. Und er fragt sich, ob dieser zur Erreichung seines Ziels wie Hitler, Stalin und Mao über Millionen Leichen stolzieren wird.
Selbstverständlich kommt in dieser Biografie Donald Trump ausgiebig vor. Wie sollte es auch anders sein, ein diabolisches Duo, das fortwirkt, trotz Bruch der Männerfreundschaft nach dem kurzen Intermezzo von Musk an der Seite des 47. Präsidenten der USA. Der Vergleich mit Trump befördert weitere Erkenntnisse. »Der Kerl lügt auf Teufel komm raus«, urteilt Seeßlen über Trump. Es sei aber »eine vulgäre und persönliche Form von Lüge«. Musks Lügen nennt der Autor »dreister und universaler«. Beide eine zudem ein auffälliger Infantilismus. »Bei Musk ist mehr Phantasma im Spiel, ... die Welt ist für ihn ein gewaltiges Kinderzimmer, in dem er alles spielen kann, was er will, eben auch Weltherrschaft, eben auch ›Kinder-Machen‹, eben auch Kaputtmachen, was nicht mehr gefällt.« Apropos, dessen öffentlich-zelebriertes Vatersein wird in dieser Biografie ebenso eingehend untersucht wie dessen (Nicht-)Beziehung zu Frauen.
Trump wie Musk vereint, dass sie es »im Hintergrund« nicht aushalten, ins Rampenlicht drängen und jeden wegschubsen, der im Wege steht, wenn’s sein muss auch ihresgleichen. »Musk und Trump haben die Welt verändert, gemeinsam und gegeneinander«, schreibt Seeßlen, um sodann herabzusteigen von der Metaebene psychologischer Reflexion in die ganz konkrete, global gegebene, irrwitzige gesellschaftliche Realität. »Aber auch in der Inszenierung von alledem wird deutlich, dass es sich weder um eine hyper-rationale Verschwörung der zwei Superputschisten Musk und Trump allein handelt, noch um das Wüten zweier psychosozial schwer gestörter Charaktere, die von der Gunst der Stunde ins Zentrum von Macht und Reichtum getragen wurden, sondern um Krisen und Transformationen, die aus der Logik des Doppelsystems von Kapitalismus und Demokratie entstehen.«
Zum Schluss wünscht sich der Autor mehr Gegenwind: »Die Welt muss sich, wenn sie Konzepte von Solidarität, Inklusion und Empathie behalten will, vom Muskismus und vom Mythos Musk befreien.« Georg Seeßlen visioniert: »Es ist in der Tat wie ein Erwachen aus einem seltsamen Traum von Zukunft. Mehr und mehr Menschen erkennen, dass sie in einer Musk-Zukunft vielleicht doch nicht leben wollen.« Ja, das wäre schön. Diese Biografie offeriert jedenfalls ein famoses politisches Lehrstück.
Georg Seeßlen: Elon Musk – der dunkle Visionär. Geld, Frauen, Pop und Tech-Faschismus. Bertz + Fischer, 352 S., br., 22 €.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.