- Politik
- Parlamentswahl
Wer wird den Irak regieren?
Bei der Parlamentswahl hofft der amtierende Regierungschef Al-Sudani auf eine Wiederwahl

Viel Aufsehen erregen die irakischen Parlamentswahlen international nicht, auch nicht in der Region. Die Öffentlichkeit schaut eher nach Washington, wo die US-Regierung dem syrischen Übergangspräsidenten den roten Teppich ausrollt. Dabei steht für die Menschen viel auf dem Spiel. Wird der amtierende Regierungschef Mohammad Schia Al-Sudani die Chance auf eine zweite Amtszeit erhalten? Er gehört einer der großen schiitischen Parteien an.
Al-Sudani kam 2022 mit der Unterstützung einer Gruppe pro-iranischer Parteien an die Macht, hat sich seitdem jedoch bemüht, die Beziehungen des Irak zu Teheran und Washington auszugleichen. Er präsentiert sich gern als Pragmatiker, der sich auf die Verbesserung der staatlichen Dienstleistungen konzentriert. Das chronisch unsichere, regelmäßig von schweren Bombenanschlägen erschütterte Land ist in den vergangenen Jahren spürbar zur Ruhe gekommen. Die Menschen treibt derzeit vor allem die fehlende Arbeit um.
Während Al-Sudanis erster Amtszeit erlebte der Irak eine relative Stabilität, doch der Weg zu einer zweiten Amtszeit könnte steinig werden. Seit 2003 hat nur ein einziger irakischer Premierminister, Nuri Al-Maliki, mehr als eine Amtszeit absolviert. Das Wahlergebnis wird nicht unbedingt Aufschluss darüber geben, ob Al-Sudani im Amt bleiben kann. Bei mehreren vergangenen Wahlen im Irak war es dem Block, der die meisten Sitze gewonnen hatte, nicht gelungen, seinen bevorzugten Kandidaten durchzusetzen.
Laut Gesetz müssen 25 Prozent der 329 Sitze im Parlament an Frauen vergeben werden.
Zu vergeben sind 329 Parlamentssitze. Antreten werden 7744 Kandidaten, von denen die meisten aus einer Reihe von weitgehend konfessionell ausgerichteten Parteien stammen; dazu treten auch ein paar unabhängige Kandidaten an. Etwa 40 Prozent der registrierten Kandidaten sind unter 40 Jahre alt, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters – ein Beleg dafür, dass die neue Generation mit der politischen Dominanz älterer Machtnetzwerke brechen will. Zu den konkurrierenden Wahlbündnissen gehören schiitische Blöcke unter der Führung des ehemaligen Premierministers Al-Maliki, des Geistlichen Ammar Al-Hakim und mehrerer mit bewaffneten Gruppen verbundener Gruppen; konkurrierende sunnitische Fraktionen unter der Führung des ehemaligen Parlamentspräsidenten Mohammad Al-Halbusi und des derzeitigen Parlamentspräsidenten Mahmud Al-Maschhadani; sowie die beiden wichtigsten kurdischen Parteien, die Demokratische Partei Kurdistans und die Patriotische Union Kurdistans.
Mehrere mit dem Iran verbundene schiitische Milizen nehmen über verbündete politische Parteien an den Wahlen teil: die Kataeb-Hisbollah-Miliz mit ihrem Block Harakat Hoquq (Bewegung für Rechte) und der Sadiqun-Block unter der Führung des Anführers der Asaib-Ahl-Al-Haq-Miliz, Qais Al-Khazali. Ob die Islamische Republik ihren Einfluss im Irak halten oder gar ausbauen kann, ist die große Frage, die sich viele Beobachter stellen. Nach dem Krieg zwischen Israel und dem Iran sind die Möglichkeiten der geschwächten Führung in Teheran jedoch deutlich reduziert, um ihre Macht im Nachbarland ausspielen zu können.
Mehrere schiitische Listen, die einst von Teheran aus koordiniert wurden, treten gegeneinander an, was wohl eine Verlagerung hin zu einer interessenorientierten Politik darstellt anstelle einer einheitlichen pro-iranischen Ausrichtung. Um diese Rivalitäten einzuhegen, entsandte die iranische Regierung Anfang Oktober den Kommandeur der Al-Quds-Truppe, Esmail Qaani, nach Bagdad, berichtet die US-amerikanische Nachrichtenwebseite Radio Free Europe/Radio Liberty. Ob seine Mission erfolgreich war, bleibt unklar.
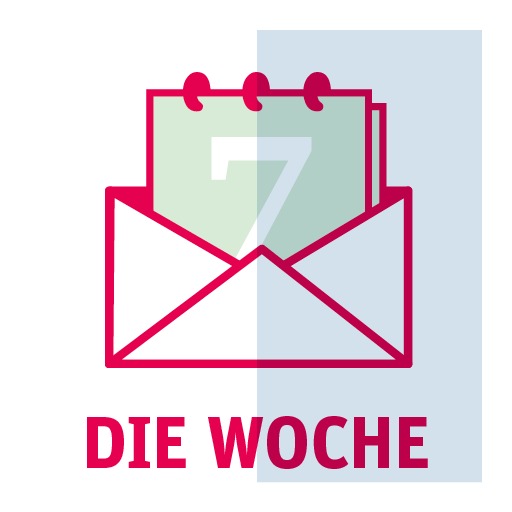
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Einige Beobachter machen unter der irakischen Bevölkerung eine größere Hoffnungslosigkeit aus als je zuvor und erwarten einen neuen Tiefstand bei der Wahlbeteiligung. Lag diese 2005 noch bei 80 Prozent, rutschte sie 2014 auf 60 Prozent ab und erreichte bei den Wahlen 2021 nur noch 43 Prozent. Von den 32 Millionen Wahlberechtigten haben nur 21,4 Millionen ihre Daten aktualisiert und Wählerausweise erhalten – bei den Parlamentswahlen im Jahr 2021 waren noch etwa 24 Millionen Wähler registriert.
Laut Gesetz müssen 25 Prozent der 329 Sitze im Parlament an Frauen vergeben werden, neun Sitze sind für religiöse Minderheiten reserviert. Das von den US-Besatzern nach 2003 etablierte, aber bereits in den 90er Jahren von irakischen Oppositionsgruppen ersonnene System der Machtteilung (Muhasasa) erinnert stark an den Libanon. Gemäß konventioneller Übereinkunft geht der Posten des Parlamentspräsidenten an einen Sunniten, während der Premierminister immer ein Schiit sein muss und der Präsident ein Kurde. Kritiker dieses Machtverteilungssystems sehen darin einen der Hauptgründe für die Vertiefung der gesellschaftlichen Trennlinien zwischen den Ethnien und Konfessionen und für die damit einhergehende Gewalt.
Bei den vergangenen Wahlen 2021 erhielt der Block des schiitischen Geistlichen Muktada Al-Sadr die meisten Stimmen aller Parteien, doch seine Bemühungen, eine Regierung mit sunnitischen und kurdischen Parteien zu bilden, scheiterten. 2022 kündigte er seinen Rückzug aus der Politik an. Für diese Wahl hat er zum Boykott aufgerufen.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.






