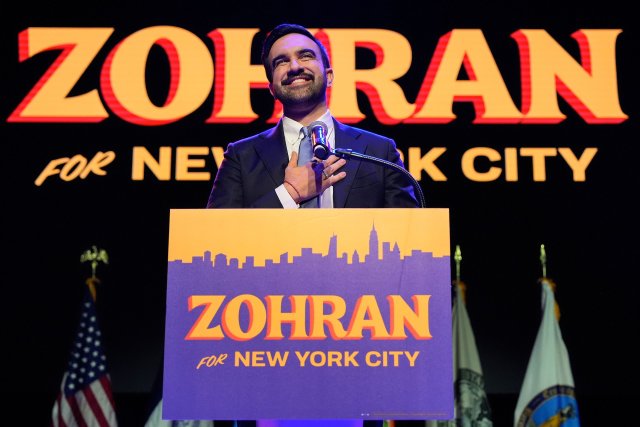- Politik
- ND-Serie: Brennpunkt Iran
Bösewicht oder Unschuldslamm?
Teil 1 der ND-Serie: Drohungen sind im Falle Irans ebenso erklärbar wie Bedrohungsängste / Der Streit um das iranische Atomprogramm – Vorwürfe, Verdachtsmomente, Lösungsansätze
Im Streit um das iranische Nuklearprogramm wird häufig in Schwarzweiß gemalt. Die Schattierung richtet sich nach der politischen Ausrichtung des Betrachters. Für die einen ist Iran ein (un)heimlicher Atomwaffenaspirant, der illegal an der Bombe bastelt. Wenn überhaupt, könnten ihn nur Druck und Gewalt daran hindern. Für andere ist Teheran das verfolgte Unschuldslamm, das nichts Schlimmes im Schilde führt und die Nuklearenergie ausschließlich friedlich nutzen will. Trotzdem werde es haltlos verdächtigt.
Völkerrechtskonform oder vertragsbrüchig?
Möglicherweise aber ist die Wahrheit komplizierter und erfordert, einige grundlegende Zusammenhänge etwas genauer anzuschauen. Dazu gehört die Frage, ob sich Iran gemäß seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen aus dem Kernwaffensperrvertrag verhält und die entsprechenden Bestimmungen der Internationale Atomenergieagentur (IAEA) als dessen Kontrolleur einhält. Iran hat sich mit seinem Beitritt zum Kernwaffensperrvertrag im Jahre 1970 zum Verzicht auf Atomwaffen verpflichtet und schloss vertragsgemäß eine Vereinbarung über Sicherungskontrollen mit der Atomagentur ab. Dieses Kontrollverfahren erwies sich jedoch spätestens nach dem zweiten Golfkrieg 1991 als unzureichend, als klar wurde, dass Irak illegal an der Entwicklung von Atomwaffen gearbeitet hatte, ohne von der IAEA entdeckt zu werden.ND-Serie
Inzwischen gibt es ein Zusatzkontrollprotokoll, in dem die Staaten sich deutlich schärferen Kontrollen ihrer Nuklearaktivitäten unterwerfen. Teheran hat es im Dezember 2003 unterschrieben, aber bisher nicht ratifiziert, akzeptiert jedoch freiwillig die umfassenden Inspektionsbestimmungen.
Iran ist kein Neuling auf dem Gebiet der Nutzung von Atomtechnologie. Bereits seit Mitte der 70er Jahre läuft ein Programm zur Uranförderung. Seit 1995 baut Iran mit russischer Unterstützung ein Kernkraftwerk in der Hafenstadt Bushehr am Persischen Golf im Süden des Landes. Es soll kommendes Jahr ans Netz gehen, ein zweiter Reaktor ist bereits vereinbart. Laut Regierungsangaben ist außerdem geplant, eine Uranmine bei Sawand in Zentraliran auszubeuten sowie weitere Anlagen für die Erzanreicherung zu reaktortauglichem Nuklearbrennstoff zu errichten. Teheran will in den kommenden 20 Jahren vor allem mit Russlands Hilfe Atomreaktoren von insgesamt 7000 Megawatt Leistung bauen. Außerdem gibt es in Iran gegenwärtig mehr als ein Dutzend weiterer zumeist kleinerer Atomeinrichtungen, die nach offiziellen Angaben der Forschung dienen. Das Ausmaß und die Ausgestaltung all dieser Anlagen, so der Vorwurf der Kritiker, seien mit zivilen Bedürfnissen nicht zu rechtfertigen.
Andererseits ist Iran gegenwärtig weitestgehend in das bestehende Regime der Nichtverbreitung von Atomwaffen eingebunden. Auch die von Teheran betriebene Urananreicherung bedeutet an sich keinen Völkerrechtsbruch. Der Nichtverbreitungsvertrag gestattet ausdrücklich die friedliche Nutzung der Kernenergie, einschließlich der Urananreicherung zur Herstellung von Brennstoff für Atomkraftwerke, solange sie unter IAEA-Kontrolle steht. Erst wenn die internationalen Inspektoren nachweisen sollten, dass die Anreicherung von Natururan den für die friedliche Nutzung erforderlichen Anreicherungsgrad übersteigt, wäre das vertragswidrig.
Wo ist der rauchende Colt?
Worauf basieren dann aber Vorwürfe und Verdachtsmomente? Die IAEA kam nach zahlreichen Überprüfungen zu zwiespältigen Schlussfolgerungen. Erstens hat Iran heimlich jahrelang Forschungsarbeiten an der Anreicherungstechnik betrieben, statt sie wie gefordert der IAEA zu melden. Außerdem fanden Inspektoren in Gasultrazentrifugen Spuren hoch angereicherten Urans. Die iranische Seite erklärte die Uranreste mit Verunreinigungen importierter Elemente und versicherte, selber niemals hochgradig angereichertes Uran produziert zu haben. Die Bauteile stammen nach Ansicht von Experten zwar vermutlich aus Pakistan. Trotzdem hat der Fund waffenfähigen Urans weltweites Misstrauen erzeugt. Die IAEA kritisiert in ihrem jüngsten Bericht: »Iran hat nicht alle notwendigen Informationen geliefert und der Agentur auch den Zugang zu Dokumenten und zu Personen verwehrt.« Andererseits hätten die Inspektoren aber »keine Beweise dafür gefunden», dass Iran »gegenwärtig versucht, sein Nuklearprogramm für militärische Zwecke zu nutzen«.
Grundlage für die unbeantworteten Fragen sind 18 iranische Dokumente, die die Agentur von überwiegend US-amerikanischen Geheimdiensten erhalten hat. Danach soll das Land in den 90er Jahren für die Herstellung von Atomwaffen erforderliche Tests mit hochexplosivem Sprengstoff sowie Entwicklungsstudien für einen atomaren Raketensprengkopf durchgeführt haben. Um das verspielte Vertrauen wiederzuerlangen, ist Iran aufgefordert, die Urananreicherung einzustellen und damit seine ausschließlich friedlichen Absichten zu beweisen.
Es könnte sein, dass Iran die Fähigkeiten zur Herstellung eigener Kernwaffen dadurch erreichen will, dass es den gesamten Atomkreislauf – Uranförderung, Herstellung der Brennstäbe und Anreicherung bzw. Wiederaufbereitung – beherrscht. Das in der Uran-Konversionsanlage von Isfahan produzierte Uran-Hexafluorid und das von rund 3500 Gaszentrifugen in Natans angereicherte Uran könnten nach Expertenmeinung zu Ausgangsstoffen für Atombomben werden. Bis auf 6000 Zentrifugen will Teheran den Bestand noch in diesem Jahr aufstocken. Außerdem entsteht ein unterirdischer Schwerwasserreaktor für die Produktion waffenfähigen Plutoniums bei Arak. Hier können neben Elektroenergie jährlich auch 8 bis 10 Kilogramm Plutonium anfallen – genug für zwei nukleare Sprengsätze.
Ein weiterer Verdacht richtet sich auf die Kraftwerksanlage »Kalaya Electric Company« nahe Teheran, wo auch Gaszentrifugen und angereichertes Uran vermutet werden. Nachdem Inspektoren zunächst der Zutritt zu einzelnen Räumen des Werkes verwehrt worden war, erhielten sie später Zugang, stellten jedoch »beträchtliche Veränderungen« fest.
Die mit dem Feuer spielen
Experten gehen davon aus, dass Iran in ein bis zwei Jahren Atomwaffen besitzen und jährlich 25 bis 30 Atomsprengköpfe herstellen könnte. Die USA haben deshalb wiederholt gedroht. George W. Bush versichert zwar immer wieder, er bevorzuge eine diplomatische Lösung, fügt aber stets hinzu: »Die militärische Option bleibt auf dem Tisch.« Doch das ist eine höchst gefährliche Politik.
Warum aber, wenn das Risiko so groß ist, betreibt Iran – teilweise sogar begleitet von provokativen Worten und Taten – sein ambivalentes Atomprogramm, das ihm einen tödlichen Hagel gegnerischer Bomben bescheren könnte? Die Antwort mag verwundern. Gerade weil in Teheran die Angst wächst, nach dem Irak-Krieg könnte Iran das nächste Ziel auf der US-amerikanischen Liste für militärische Präventivschläge sein, geht es in die Offensive. Anscheinend zieht die iranische Führung aus den Kriegen gegen Afghanistan, Irak und auf dem Balkan sowie aus der Behandlung der neuen Nuklearmacht Nordkorea die Lehre: Nur wer selber Atomwaffen besitzt, ist vor einem Angriff sicher.
Aus der Sicht Teherans sind Bedrohungsängste durchaus erklärbar, denn außer den israelischen Nuklearwaffen gibt es weitere Verunsicherungen. Die direkten Nachbarstaaten Irak und Afghanistan sind militärisch von den USA besetzt, von der Kernwaffenmacht also, die Iran auf der »Achse des Bösen« platziert hat. Anscheinend gibt es in Iran aber noch keine endgültige Festlegung des zukünftigen Kurses. Widersprüchliche Reaktionen auf UNO- und IAEA-Beschlüsse wie auch auf die von den europäischen Staaten unterbreiteten Vorschläge deuten auf gegensätzliche Positionen innerhalb der iranischen Führung hin.
Welches ist die richtige Strategie?
Es gehört zu den Grundregeln der Diplomatie, dass Lösungen ein gegenseitiges Geben und Nehmen erfordern. Druck und Sanktionen müssen durch Kooperationsangebote ergänzt werden. Dazu gehören Anreize, die auch die iranischen Interessen berücksichtigen. Vorstellbar wären eine Nichtangriffserklärung und Sicherheitsgarantien, die mit der Autorität des UN-Sicherheitsrats politisches Gewicht bekämen. Der wirksamste Weg zu Frieden und Stabilität im Nahen und Mittleren Osten aber wäre die Schaffung einer von Massenvernichtungswaffen freien Zone in der Region.
Als verlockend könnte sich darüber hinaus die Aufhebung von Wirtschaftssanktionen erweisen, ebenso wie wissenschaftlich-technische Hilfe und weitere Unterstützung in der Wirtschaft und bei der Stromversorgung. Auch die Sicherung der Brennstoffversorgung könnte mit einer Auslagerung der Urananreicherung erreicht werden. Ein Vorschlag der IAEA liegt bereits seit längerem auf dem Tisch. Er besteht darin, die »sensitiven Elemente« nuklearer Brennstoffkreisläufe zu »multilateralisieren«, also in internationalen Kernbrennstoffzentren zu betreiben.
Zwei Wege
Die Herstellung eines nuklearen Sprengsatzes kann auf zwei Wegen erfolgen:
1. Aus dem Isotop Uran (U 235), das im Natururanerz aber nur zu 0,7 Prozent enthalten ist. Zum Bombenbau muss es deshalb mittels Gaszentrifugen auf etwa 90 Prozent angereichert werden. Je nach Technologie werden für einen Atomwaffensprengsatz 12 bis 25 kg hoch angereichertes Uran benötigt.
2. Aus Plutonium 239, das aber in der Natur so gut wie nicht vorkommt. Es entsteht, wenn U 238 ein weiteres Neutron einfängt und damit zu Pu 239 wird. Dieses lässt sich spalten. 5 bis 8 kg Plutonium reichen für einen Atomsprengsatz aus, sie können beispielsweise bei der Stromerzeugung in einem Kernreaktor (»Schneller Brüter«) oder durch die Wiederaufbereitung ausgebrannter Brennstäbe gewonnen werden.
Der Vertrag
Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (Zusammenfassung der Hauptbestimmungen)
Artikel I Die Kernwaffenstaaten verpflichten sich, Kernwaffen an niemanden weiterzugeben und Nichtkernwaffenstaaten weder zu unterstützen noch zu ermutigen, Kernwaffen herzustellen oder zu erwerben.
Artikel II Die Nichtkernwaffenstaaten verpflichtet sich, Kernwaffen nicht herzustellen oder zu erwerben.
Artikel III Kontrolle durch die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) auf der Grundlage individueller Abkommen
Artikel IV Recht auf Erforschung, Erzeugung und Verwendung der Kernenergie für friedliche Zwecke. Verpflichtung zum Austausch von Ausrüstungen, Material und wissenschaftlichen und technologischen Informationen zur friedlichen Nutzung der Kernenergie
Artikel V Recht auf überirdische friedliche Kernexplosionen (obsolet, da aus Umweltgründen keine mehr durchgeführt werden)
Artikel VI Verpflichtung zu Verhandlungen über Beendigung des nuklearen Wettrüstens, nukleare Abrüstung sowie allgemeine und vollständige Abrüstung unter internationaler Kontrolle
Artikel VII Recht zur Bildung kernwaffenfreier Zonen
Artikel VIII Bestimmungen für Vertragsänderungen
Artikel IX Unterzeichnungs- und Ratifikationsbestimmungen
Artikel X Bei Gefährdung der höchsten Landesinteressen Recht auf Rücktritt nach dreimonatiger Kündigungsfrist
Teil 2 der Serie am 4. 10.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.